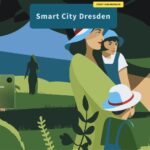E-Government in EuropaLeitfaden für Liverpool

Der Smart-City-Leitfaden für Liverpool umfasst vier Aktionsbereiche.
(Bildquelle: vichie81/stock.adobe.com)
Viele europäische Städte befinden sich aktuell im Übergang zu einer Smart City. In diesem Zuge müssen sie ein Datenökosystem entwickeln sowie intelligente und datengesteuerte Lösungen für wirtschaftliche, soziale und ökologische Probleme implementieren. Auch die nordenglische Stadt Liverpool und ihre angrenzende Region sahen sich mit diesen Aufgaben konfrontiert. Dabei hat die Region den Vorteil, dass sich die Kommunalbehörden der Liverpool City Region Combined Authority (LCRCA) und der Liverpool City Region (LCR) der Wichtigkeit einer Smart-City-Agenda und der Bedeutung leistungsfähiger Dateninfrastrukturen bewusst sind. Auch bestehen gute Verbindungen zur Industrie und zu ansässigen kleinen und mittleren Unternehmen. Weitere Vorteile sind durch das 5G-Netzwerkprogramm, die Sensor-City-Initiative und das Forschungszentrum für Verbraucherdaten an der Universität Liverpool gegeben.
Unterstützung aus Deutschland
Trotz dieser vielversprechenden Grundlagen muss die Region zahlreiche Herausforderungen bewältigen: Der Aufbau einer Smart City im politisch-wirtschaftlich-institutionellen Kontext einer sich in der Erneuerung befindenden Stadt birgt ohnehin schon Schwierigkeiten. Zudem existieren in Liverpool spezifischere Hindernisse in Bezug auf die institutionelle Landschaft und die lokale Datenstrategie. So fehlen beispielsweise eine übergreifende, gemeinsam vereinbarte Strategie, ein technischer Rahmen, ein Leitbild sowie eine Reihe von Datenstandards, um lokale Interessengruppen mobilisieren und vereinen zu können. Daten und ihr Wert werden daher in der Region nur unzureichend genutzt.
Aus diesen Gründen haben sich das Heseltine Institute for Public Policy, Practice and Place sowie die LCRCA an die Experten des deutschen Unternehmens Bable und des Fraunhofer-Instituts für Offene Kommunikationssysteme FOKUS gewandt, um einen Smart-City-Leitfaden für die Region erstellen zu lassen. Ziel dieses Leitfadens ist es, einen Überblick über bewährte Praktiken beim Aufbau von Smart Cities und Datenökosystemen zu erstellen, sodass die Akteure in der Region von den Erfahrungen aus anderen Projekten profitieren können.
Datenpotenzial ausschöpfen
Eine oftmals genannte Kernherausforderung, vor der die Verantwortlichen in den Städten stehen, ist die immense Ausweitung des Datenzugangs für Akteure des öffentlichen, privaten und dritten Sektors. Fundamental ist hierbei die optimale Ausschöpfung des Potenzials der Daten, um bei der Suche nach Lösungen für kritische wirtschaftliche, soziale und ökologische Probleme zu helfen und gleichzeitig die Zustimmung der relevanten Stakeholder und Bürger zu erhalten. Denn es gilt: Leistungsfähige Datenökosysteme sollten nur existieren, um Kommunalbehörden dabei zu helfen, das Leben ihrer Bürger zu verbessern.
Die Praktiken, die innerhalb des Leitfadens vorgestellt werden, umfassen unter anderem Prozesse und Ergebnisse aus besonders innovativen europäischen Städten. Auf Basis dieser Fallstudien und der Erfahrungen der Experten wurden vier Aktionsbereiche mit insgesamt zwölf Schlüsselthemen definiert. Der Aktionsbereich eins umfasst die Grundlagen und Vorbereitungen, die erforderlich sind, um mit der Organisation eines Datenökosystems beginnen zu können. Darunter fällt zum einen die Begründung für die Datenpläne mit Spezifizierung von Werten, Zielen und Vorgaben, die der Planung zugrunde liegen und zum anderen das Stakeholder-Mapping, also die Kartierung der wichtigsten Stakeholder und Nutzergruppen in städtischen Datenökosystemen. Darüber hinaus geht es in diesem Aktionsbereich um die Durchführung von Audits von Schlüsseldatensätzen, die am häufigsten in Datenökosystemen verwendet werden.
Aktionsbereiche und Schlüsselthemen
Es folgen im zweiten Aktionsbereich die notwendigen Vorkehrungen in den Bereichen Governance, Management, Ethik und Regulierung, um den grundlegenden Rahmen zu setzen. Dies umfasst die Identifizierung effektiver Governance-Mechanismen sowohl für den Entwurf als auch für die Umsetzung von Plänen, das Regieren im Interesse des Gemeinwohls sowie praktische Anleitungen zum Umgang mit Fragen der Datenethik.
Der dritte Aktionsbereich befasst sich mit technischen Infrastrukturen und Herausforderungen, die für ein integriertes Ökosystem grundlegend sind, also zum einen mit dem Aufbau von (offenen) Datenökosystemen und der Förderung der Interoperabilität. Dabei geht es darum, institutionelle und kulturelle Reformen anzuregen, die möglicherweise erforderlich sind, wenn Datensätze interoperabel gemacht werden sollen sowie um die Erstellung von Protokollen für die Sammlung, Zusammenstellung und gemeinsame Nutzung von Daten. Ein weiteres Schlüsselthema dieses Bereichs ist die Investition in angemessene Hard- und Software und die Ermittlung technologischer und infrastruktureller Verbesserungen, die wirksame Datenökosysteme untermauern sowie der Schutz der IT-Sicherheit, Fragen des Datenschutzes und der Vertraulichkeit sowie die Milderung von Durchbrüchen von Daten-Firewalls. Zudem fallen darunter Überlegungen zur Datenvisualisierung und zum Wert der Entwicklung eines City-Dashboards oder eines gleichwertigen Systems. Der vierte Aktionsbereich adressiert Ressourcen, Finanzen und Wirtschaft. Im Fokus stehen die Beschaffung von Smart-City-Infrastruktur und die Maximierung der Ausgaben sowie die Durchführung einer Kosten-Nutzen-Analyse der Umsetzung eines neuen stadtbasierten Daten-Management-Plans.
Handlungsempfehlungen für den Wandel
Im Rahmen des dritten Aktionsbereichs Technische Infrastrukturen und Herausforderungen wurden der Region Liverpool beispielsweise spezielle Maßnahmen auf dem Weg zur Smart City, basierend auf dem oupPLUS-Ansatz, vorgeschlagen. Hierbei konnten die Experten auf innovative, gleichzeitig aber bewährte Konzepte aus anderen Großstädten zurückgreifen und auf die englische Region übertragen. Dabei nutzten sie auch die Erfahrungen, die sie bei der Erstellung der DIN-Spec 91357 (Referenzarchitekturmodell Offene Urbane Plattform (OUP)), DIN-Spec 91367 (Urbane Mobilitätsdatensammlung für Echtzeitapplikationen) sowie der aktuell noch unveröffentlichten DIN-Spec 91397 (Leitfaden für die Implementierung eines Quartiersmanagements) gesammelt haben.
Die untersuchten zwölf Schlüsselthemen sind auch für andere europäische Städte, die zur Smart City werden wollen von Relevanz. Die Studie bietet Stakeholdern, die an einer nachhaltigen Entwicklung einer intelligenten Stadt interessiert sind und sich aktiv daran beteiligen möchten, erste Handlungsempfehlungen für den Wandel.
https://www.fokus.fraunhofer.de/sqc
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe August 2020 von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.
Duisburg: Smart City sucht Bürgerideen
[17.04.2025] Ihren Smart-City-Masterplan will die Stadt Duisburgs gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickeln. Noch bis Ende Mai können diese ihre Ideen online einbringen. Die Stadt will alle Vorschläge sichten, bewerten und, sofern möglich, in den neuen Masterplan einbringen. mehr...
Stuttgart: Smart-City-Masterplan in Arbeit
[16.04.2025] Unter Beteiligung der Stadtgesellschaft erarbeitet Stuttgart einen umfassenden Smart-City-Masterplan. In Workshops diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft entsprechende Ideen und Projekte. Online können außerdem Vorhaben bewertet und kommentiert werden. mehr...
Leipzig / Landau in der Pfalz: Modellstädte für KI-gestützte Verkehrssteuerung
[15.04.2025] Die Städte Leipzig und Landau in der Pfalz werden als Pilotregionen im Forschungsprojekt AIAMO (Artificial Intelligence And MObility) an der KI-gestützten Verkehrssteuerung arbeiten. Die Ergebnisse sollen auf kleine und mittlere Kommunen übertragbar sein. mehr...
Regionalkonferenz MPSC: Smart sein
[11.04.2025] Wie Städte digital und nachhaltig wachsen können, steht im Mittelpunkt der 22. Regionalkonferenz des Bundesprogramms Modellprojekte Smart Cities am 3. Juni 2025 in Halle (Saale). mehr...
Interkommunale Zusammenarbeit: Smarte Daten helfen Bauhöfen
[11.04.2025] Daten aus Sensoren und eine App unterstützen die Orte Nauheim, Trebur und Büttelborn dabei, Baumbewässerung und Streueinsätze gezielt zu planen und künftig auch die Beleuchtung bedarfsabhängig zu steuern. Die Kommunen haben das Projekt gemeinsam umgesetzt. mehr...
Digitale Verkehrssteuerung: KIMONO sorgt für Neustart
[10.04.2025] Kaiserslautern hat seiner verkehrstechnischen Infrastruktur bis 2033 eine umfassende Modernisierung und Digitalisierung verordnet. Von den im Rahmen des Projekts KIMONO entstehenden Lösungen können auch andere Kommunen profitieren. mehr...
Hamburg: Parkraum effizient prüfen
[09.04.2025] In Hamburg können Parkberechtigungen digital beantragt und von den Kontrollkräften online überprüft werden. In Zukunft sollen Scan-Fahrzeuge für noch mehr Effizienz bei der Parkraumkontrolle sorgen – vorausgesetzt, die rechtliche Grundlage wird geschaffen. mehr...
Kreis Hameln-Pyrmont: Smart City geht in Verlängerung
[09.04.2025] Der als Modellprojekt Smart Cities geförderte Kreis Hameln-Pyrmont hat die kostenneutrale Verlängerung der Projektlaufzeit um ein Jahr beantragt – mit Erfolg. Durch den zeitintensiven Abstimmungsbedarf wäre der ursprünglich vorgesehene Zeitraum bis Ende 2026 zu kurz für die Kommune gewesen. mehr...
Interkommunales Netzwerk: Mobiler in der Ortenau
[08.04.2025] Das Mobilitätsnetzwerk Ortenau setzt auf nachhaltige Verkehrslösungen und will die analoge sowie digitale Verkehrsinfrastruktur verbessern. Wie die 14 Kommunen vorgehen, erläutert Sarah Berberich, Geschäftsführerin des Beratungsunternehmens endura kommunal. mehr...
Wolfsburg: Mehr als ein Parkleitsystem
[07.04.2025] Die Stadt Wolfsburg plant – ergänzend zu den Informationen, die sie per App übermittelt – ein dynamisches Parkleitsystem in der Innenstadt. Dieses soll eine effiziente Verkehrssteuerung ermöglichen und darüber hinausgehende Informationen liefern, etwa zu Veranstaltungen. mehr...
Fraunhofer FOKUS: Digital Twin hilft beim Routing
[02.04.2025] Das Smart-Mobility-Team von Fraunhofer FOKUS hat im Projekt KIS’M eine Fahrrad-App entwickelt, die auf einem digitalen Zwilling des Berliner Straßenverkehrs basiert. Die App berücksichtigt individuelle Präferenzen bei der Routenplanung und bietet einen Ampelphasenassistenten. mehr...
Local Digital Twins Toolbox: EU-Projekt für Kommunen
[31.03.2025] Mit der Local Digital Twins Toolbox unterstützt die Europäische Kommission Kommunen bei der Einführung entsprechender Lösungen. Teilnehmende Städte und Gemeinden bekommen wichtige Werkzeuge an die Hand und werden individuell beraten. mehr...
Dresden: Website zu Smart-City-Projekten
[31.03.2025] Eine neue Website mit Informationen zu ihren Smart-City-Projekten hat die Stadt Dresden jetzt online gestellt. Zu den momentan 17 geförderten Vorhaben zählen unter anderem die Entwicklung eines interaktiven 3D-Stadtmodells und ein Testfeld für zukunftsfähige Verkehrsstrukturen. mehr...
Landkreis Wunsiedel: Digitaler Zwilling im Aufbau
[31.03.2025] Der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge soll einen Digitalen Zwilling bekommen. Die Ausschreibung für die Anschaffung der nötigen LoRaWAN-Technologie ist bereits gestartet. Erste Anwendungen sollen noch in diesem Jahr in Betrieb gehen, insbesondere im Bereich Katastrophenschutz. mehr...
Troisdorf: Mit der smarT:app die Freizeit gestalten
[28.03.2025] Die smarT:app der Stadt Troisdorf unterstützt Nutzende mit einer interaktiven Karte jetzt auch bei der Freizeitgestaltung. mehr...