Kita-AppsVon der Zettelwirtschaft zur digitalen Kommunikation
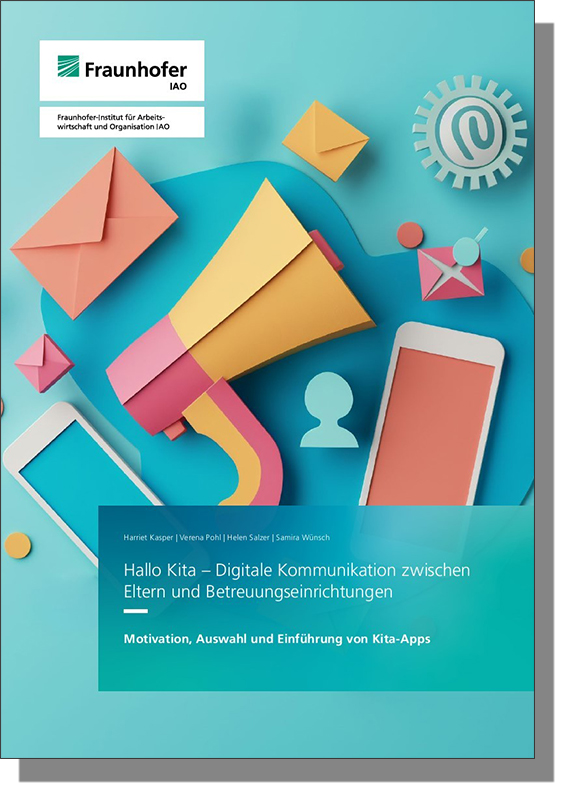
Die Studie des Fraunhofer-Instituts zeigt Vorteile von Kita-Apps und gibt konkrete Hinweise zur Einführung.
(Bildquelle: Fraunhofer IAO)
Die Digitalisierung der Kommunikation zwischen Eltern und Kindertagesstätten (Kitas) bietet immense Vorteile. Kita-Apps werden immer häufiger genutzt. Sie steigern die Effizienz, ermöglichen datenbasierte Entscheidungen und erhöhen die Resilienz in Krisensituationen. Das geht aus der aktuellen Studie „Hallo Kita – Digitale Kommunikation zwischen Eltern und Betreuungseinrichtungen“ des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO hervor.
Strukturiertes Vorgehen
„Unsere Studie soll Kita-Träger, die noch keine Kita-App nutzen, motivieren und unterstützen“, sagt Harriet Kasper, Co-Autorin und Wissenschaftlerin am Fraunhofer IAO. Die Studie zeigt den Nutzen für die verschiedenen Akteure auf und stellt ein Vorgehensmodell vor, das die Auswahl und Einführung solcher Apps erleichtern soll. Dieses besteht aus fünf Schritten:
- Bedarfsermittlung: Informationssammlung und einfache Befragungen zur Ermittlung des Bedarfs.
- Anforderungsdefinition: Workshops mit den zukünftigen Nutzenden zur Erstellung eines Pflichtenheftes sowie zur Ermittlung des Hardwarebedarfs und der Gesamtkosten.
- Angebotsbewertung: Einholen, Evaluation und Auswahl der Angebote.
- Systemeinführung: Systemkonfiguration, Schulungen und Supportmöglichkeiten umsetzen.
- Betrieb: Nutzung der App in den Einrichtungen und beim Träger.
Tschüss Zettel im Kita-Rucksack, hallo Kita-App
Eltern von Kita-Kindern ohne digitale Kommunikationsmöglichkeiten sehen sich laut Fraunhofer IAO mit vier zentralen Problemen konfrontiert: der Vielzahl unterschiedlicher Kommunikationskanäle, der aufwändigen Zettelwirtschaft, dem langsamen Informationsfluss und dem ineffizienten Austausch zwischen Tür und Angel. Hier setzen Kita-Apps an. Zu den Vorteilen zählen die Reduzierung des manuellen Aufwands, eine einfache und schnelle Kommunikation sowie eine bessere Vernetzung und Dialogmöglichkeiten. Dabei kommt es auf die genaue Funktionsweise der App an: „Eine Kita-App sollte einfach zu bedienen sein, geringe technische Hürden aufweisen und über ein solides Datenschutzkonzept verfügen. Wichtige Funktionen sind die Übermittlung von Krankmeldungen, die direkte Kommunikation mit der Kita, ein gepflegter Kalender und Umfragefunktionen“, erklärt Verena Pohl, Wissenschaftlerin am Fraunhofer IAO und ebenfalls Co-Autorin.
Erfolgreiche Einführung und Datenschutz
Die Auswahl und Einführung einer Kita-App liegt in der Verantwortung des Trägers, wobei der Datenschutz von Anfang an eine wesentliche Rolle spielt, berichtet Pohl. Als Praxisbeispiele wurden die mit den städtischen Kita-Trägern in Ludwigsburg, Stuttgart und Waiblingen geführten Interviews aufbereitet, um den Leserinnen und Lesern einen konkreten Eindruck solcher Projekte zu geben.
Die Autorinnen der Studie betonen die dringende Notwendigkeit einer flächendeckenden Einführung von Kita-Apps, um die Kommunikation zwischen Eltern und Betreuungseinrichtungen nachhaltig zu optimieren.
Schleswig-Holstein: Kooperation verlängert
[16.04.2025] Nach fünf erfolgreichen Jahren haben Schleswig-Holstein und der ITV.SH ihre Kooperation zur Verwaltungsdigitalisierung bis Ende 2029 verlängert. Geplant sind unter anderem der Roll-out weiterer digitaler Anträge und Unterstützung für Kommunen bei Informationssicherheits- und IT-Notfällen. mehr...
Darmstadt: Resiliente Krisenkommunikation
[11.04.2025] Großflächige, lang andauernde Stromausfälle sind selten – stellen die Krisenkommunikation jedoch vor Schwierigkeiten, weil Mobilfunk, Internet und Rundfunk ausfallen. In Darmstadt wird nun eine energieautarke digitale Litfaßsäule erprobt, die auch bei Blackouts als Warnmultiplikator funktioniert. mehr...
Diez/Kaisersesch/Montabaur/Weißenthurm: Kooperation im Prozessmanagement
[08.04.2025] Gemeinsam wollen die Verbandsgemeinden Diez, Kaisersesch, Montabaur und Weißenthurm ihre Verwaltungsprozesse effizienter gestalten. Im Fokus steht die Wissensdokumentation ihrer Prozesse. Auch sollen eine Datenbank für Notfallszenarien und ein interkommunales Prozessregister aufgebaut werden. mehr...
Hessen: Projekt Di@-Lotsen wächst weiter
[07.04.2025] Das hessische Digitallotsen-Projekt, das älteren Menschen den Zugang zur digitalen Welt erleichtern soll, wird fortgeführt und ausgeweitet. Kommunen, Vereine und andere Einrichtungen können sich bis zum 11. Mai 2025 als digitale Stützpunkte bewerben. mehr...
Berlin: Beihilfe ohne Medienbrüche
[04.04.2025] In Berlin haben Beamtinnen und Beamte nicht nur die Möglichkeit, Anträge auf Beihilfe digital zu stellen – mit einer neuen App ist es ab jetzt auch möglich, den Bearbeitungsstand einzusehen und die Bescheide digital zu empfangen. mehr...
Interkommunale Zusammenarbeit: Dritte Förderphase für Digitale Dörfer RLP
[01.04.2025] Das Netzwerk Digitale Dörfer RLP erhält bis 2026 weitere 730.000 Euro Landesförderung. Erfolgreiche Digitalprojekte sollen landesweit ausgerollt und die interkommunale Zusammenarbeit gestärkt werden. Ein Schwerpunkt liegt auf wissenschaftlich unterfütterten Pilotprojekten zum Bürokratieabbau. mehr...
Bayern: Ein Jahr Zukunftskommission
[31.03.2025] Die Zukunftskommission #Digitales Bayern 5.0 hat ihren aktuellen Bericht vorgelegt. Unter Leitung des Finanz- und Heimatministeriums erarbeiten Ministerien, Kommunalverbände und Experten Lösungen für eine einheitlichere, effizientere und sicherere IT in Bayerns Kommunen. mehr...
Rheinland-Pfalz: Projekt KuLaDig geht in die nächste Runde
[28.03.2025] Die kulturelle Vielfalt in Rheinland-Pfalz systematisch digital erfassen und für die Öffentlichkeit aufbereiten – das will das Projekt KuLaDig. Nun steht fest, welche Kommunen darin unterstützt werden, ihr kulturelles Erbe digital zu erfassen und zugänglich zu machen. mehr...
Polyteia: Wege für den Datenschutz in der Verwaltung
[27.03.2025] Einer sinnvollen Nutzung kommunaler Daten für die Entscheidungsfindung steht nicht selten der Datenschutz entgegen. Das Projekt ATLAS will zeigen, wie moderne Datenschutztechnologien in der Praxis helfen und echten Mehrwert für den öffentlichen Sektor schaffen. mehr...
Nürnberg: Vier Abholstationen für Ausweisdokumente
[26.03.2025] Die Stadt Nürnberg hat ihr Angebot an Abholstationen für Ausweisdokumente verdoppelt. An insgesamt vier Standorten können die Bürgerinnen und Bürger nun Personalausweise, Reisepässe und eID-Karten unabhängig von den Öffnungszeiten der Bürgerämter abholen. mehr...
Difu-Befragung: Kommunalfinanzen beherrschendes Thema
[25.03.2025] Eine Vorabveröffentlichung aus dem „OB-Barometer 2025“ zeigt, dass kommunale Finanzen das drängendste Thema der Stadtspitzen sind – auch mit Blick auf zukünftige Investitionen. Es sei nötig, dass Kommunen einen beträchtlichen Anteil aus dem Sondervermögen erhielten, so das Difu. mehr...
Berlin: ÖGD wird fit für die Zukunft
[25.03.2025] Mit dem Programm „Digitaler ÖGD“ werden in Berlin Grundlagen für moderne Technologien, Softwarelösungen und schlankere Prozesse in den Einrichtungen des ÖGD geschaffen. Davon können Mitarbeitende wie auch Bürgerinnen und Bürger profitieren. mehr...
Mainz: Ko-Pionier-Sonderpreis 2025
[24.03.2025] Mit dem Ko-Pionier-Sonderpreis 2025 wurde die Stadt Mainz ausgezeichnet. Dieser Preis würdigt Verwaltungen, die innovative Ansätze aus anderen Städten erfolgreich adaptieren und an ihre spezifischen Rahmenbedingungen anpassen. mehr...
LSI Bayern: Ausschuss für Kommunale Fragen zu Gast
[18.03.2025] Bei einer Sitzung des Innenausschusses im LSI standen die Bedrohungslage im Cyberraum und Schutzmaßnahmen für Bayerns IT im Fokus. LSI-Präsident Geisler stellte die Unterstützungsangebote für Kommunen vor, bevor die Abgeordneten das Lagezentrum und das Labor besichtigten. mehr...
Kreis Lüchow-Dannenberg: Ausgezeichnete Digitalisierungsstrategie
[17.03.2025] Für seine herausragende Digitalisierungsstrategie hat der Landkreis Lüchow-Dannenberg das Qualitätssiegel „Top-Organisation 2025“ des Netzwerks Silicon Valley Europe erhalten. mehr...



















