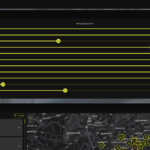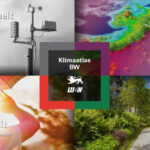Smart CityAgile Netzwerke als Erfolgsfaktor
Dubai, Barcelona und Singapur sind die Vorbilder, deutsche Kommunen wollen es werden: Smarte Städte, welche die digitale Transformation umsetzen. Einzelne Projekte zeigen, wie Kommunen smarter werden, ihre Dienstleistungen modernisieren und mit dem Bürger interagieren. Hannover zum Beispiel verfügt mit der GVH-App über eine intermodale Mobilitätsplattform. Über diese bieten große Nahverkehrsverbünde im Norden ein Ticket auf dem Smartphone an und experimentieren mit Vernetzungsangeboten zu anderen Verkehrsträgern. Köln und Aachen testen unterdessen Smart Parking, Düsseldorf und Frankfurt stellen Terminals für Passanträge auf. In Barcelona wiederum bestellen die Mülltonnen die Müllabfuhr. Gleichwohl hat in diesen Beispielen die digitale Transformation noch keine Auswirkungen auf die öffentliche Verwaltung.
Wie die Wirtschaft steht auch der öffentliche Sektor mit der Digitalisierung vor neuen Herausforderungen. Die Entwicklungszyklen der IT und Planungszeiträume werden kürzer, die Unsicherheiten steigen. Die rasanten Fortschritte bei Hard- und Software sowie Funktechnik (LTE) bei mobilen Endgeräten und innovativen Anwendungen stellen klassische Modelle der Verwaltung infrage. Viele Bürger leben bereits digital und mobil. Sie haben sich an Smart Shopping gewöhnt und kommunizieren über Social Media mit Herstellern. Auch Unternehmen erwarten schnellere Entscheidungen aus dem Rathaus, um auf Marktchancen reagieren zu können. Kurzum: Die Erwartungshaltung von Bürgern und Wirtschaft ändert sich mit der Digitalisierung grundlegend. Diese generellen Veränderungen bedeuten enorme Herausforderungen für die Verwaltungen von Kommunen, welche die aktuell vorherrschende Art und Weise der Zusammenarbeit von Menschen und Organisationen hinterfragen. Mit den bestehenden hierarchischen Organisationsformen und dem weitverbreiteten Silodenken in Ressort- und Behördengrenzen lassen sich die Erwartungen nur bedingt erfüllen. Agile Netzwerke in der öffentlichen Verwaltung sind eine vielversprechende Möglichkeit für kürzere Planungsprozesse und die schnellere Umsetzung komplexer digitaler Projekte.
Prinzipien agiler Organisationsformen
Agile Organisationsformen basieren auf Grundsätzen, die diametral zur klassischen, hierarchischen Aufbau- und Ablauforganisation im öffentlichen Sektor stehen. Agile Netzwerke zeichnen sich unter anderem durch diese Grundprinzipien aus: eine konsequente Ausrichtung zur Maximierung des Kundennutzens, eine auf Vertrauen und Verantwortung basierende Arbeitskultur, Ende-zu-Ende-Prozesse und -Zusammenarbeit, rasche Entscheidungen durch die beteiligten Mitarbeiter statt Vorgesetztenentscheidungen, transparente Prozesse sowie aktive und unkomplizierte Kooperation mit externen Organisationen oder dem Bürger. Diese Prinzipien sollten sich in agilen Netzwerken wiederfinden, auch wenn die Ausgestaltung individuell und situationsspezifisch erfolgen sollte. Jede Organisation muss ihre eigene agile Netzwerkstruktur beschreiben, damit Menschen, Prozesse und vorherrschende Strukturen bestmöglich harmonieren. Agile Netzwerke helfen dabei, Unsicherheiten bei Planung und Investitionen durch flexible Strukturen und kurze Reaktionszeiten zu begegnen. Durch das Empowerment der Mitarbeiter, die Vernetzung unterschiedlicher Expertisen und die Einbindung externen Know-hows wird versucht, Kompetenzen und Fähigkeiten zu bündeln und freizusetzen. Eine Fokussierung auf den Kunden bei allen Aktivitäten kann zu einer effektiven und effizienten Entwicklung neuer Lösungen führen, die den Kundennutzen maximieren. Die Einführung agiler Netzwerke kann durchaus parallel zu bestehenden hierarchischen Strukturen erfolgen. Die Vorteile einer effizienten und sicheren Betriebsorganisation lassen sich durch agile Netzwerkstrukturen ergänzen. Dabei sollte die inhaltliche Ausrichtung des agilen Netzwerkes mit den Vorteilen agiler Organisationsformen abgestimmt sein. Stärken wie Kundennähe, Flexibilität, Innovation und eine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit können zielgerichtet eingesetzt werden, beispielsweise bei der Entwicklung einer neuen Mobilitätsplattform.
Aufbau eines agilen Netzwerkes
Am Anfang steht die Analyse der bestehenden Strukturen wie Aufbau- und Ablauforganisation, Führungskultur, Strategie, Prozesse und Mitarbeiter. Aus diesem Assessment der agilen Bereitschaft leiten sich Zielvereinbarungen ab, bei denen das Kommitment der Führungsebene entscheidend ist. Denn ohne die Unterstützung der Entscheider und die Verlagerung der Verantwortung auf die Netzwerkebene funktioniert eine agile Arbeitsstruktur nicht. Eine wichtige Rolle für die Selbstorganisation agiler Netzwerke spielen die geteilten Visionen und Strategien, mit denen verbindliche Ziele für alle Beteiligten beschlossen werden, die eine zielgerichtete Arbeit des Netzwerkes garantieren. Ein Führungskreis unterstützt die Kommunikation und Transparenz im Netzwerk und fördert die neuen agilen Methoden im Arbeitsalltag der Mitarbeiter. Nach der Konstituierung eines agilen Netzwerkes starten Initiativen mit konkreten Use Cases. Team-Mitglieder agiler Netzwerke setzen sich je nach Aufgabenstellung aus dafür teilweise freigestellten Mitarbeitern verschiedener Verwaltungseinheiten, Partnern und Kunden (Bürgern) zusammen. Entscheidend ist auch eine agile und inkrementelle Arbeitsweise, die Lösungen schrittweise entwickelt und Kundenevaluationen zulässt. Das Beispiel Digitales Bürgeramt ist ein potenziell geeignetes Produkt für die Umsetzung in einem agilen Netzwerk. Die Funktionalitäten eines digitalen Bürgeramts bilden einzelne User Stories, die von verschiedenen Product Ownern verantwortet werden. Die Umsetzung der User Stories erfolgt inkrementell und nach agilen Methoden, wie zum Beispiel Scrum. Das agile Netzwerk bietet hierbei die Möglichkeit eines effektiven Austauschs, etwa unter den Product Ownern oder Entwicklern, um Redundanzen vorzubeugen, Synergien zu heben und das Produkt zu verbessern. Gleichzeitig werden einzelne Funktionalitäten so schnell wie möglich und sinnvoll live gesetzt, um eine schnelle Entwicklung zu ermöglichen. So wird ein möglichst umfassendes und zielgerichtetes Feedback der Anwender gewährleistet, um weitere Features und höhere Versionen mit größtmöglichem Anwendernutzen zu realisieren.
Agil zur Smart City
Erste IT-Projekte in Unternehmen und in großen Bundesbehörden arbeiten bereits mit agilen Methoden und haben positive Erfahrungen damit gemacht. Eine strukturell und grundsätzlich veränderte, agilere IT-Organisation ist der nächste Schritt und ein zentraler Erfolgsfaktor, um den Herausforderungen einer smarten Verwaltung zu begegnen. Neben der IT-Ebene, die Ausgangspunkt einer solchen Entwicklung sein kann, bedarf es einer Skalierung agiler Methoden auf alle Teile einer Verwaltungsorganisation. Auf dem Weg zur smarten Kommune bieten agile Netzwerke die Möglichkeit, innovative Lösungen und neue Entwicklungen neben dem Tagesgeschäft der Verwaltung schnell, effektiv und wertstiftend bereitzustellen.
Mönchengladbach: Regionalkonferenz Smart Cities 2025
[19.02.2025] Mönchengladbach wird am 12. März Austragungsort der Regionalkonferenz Smart Cities des BMWSB. Workshops und kurze Praxisberichte widmen sich Themen wie KI und Bürgerbeteiligung. Tags darauf findet am gleichen Ort der SmartCity.Summit Niederrhein statt. mehr...
Wolfsburg: Bundestagswahl in der Stadt-App
[18.02.2025] Die Stadt Wolfsburg will über die Integration des beliebten Wahl-O-Mat in ihre Stadt-App die Aufmerksamkeit von Bürgerinnen und Bürgern auf die bevorstehende Bundestagswahl lenken und gleichzeitig dazu beitragen, dass die Wahlentscheidung erleichtert wird. mehr...
Freiburg: Mehr Sicherheit bei Großveranstaltungen
[17.02.2025] Mehr Sicherheit bei Großveranstaltungen durch digitale Technik – so lautet der Ansatz des Projekts FreiburgRESIST. Dafür sollen in der Freiburger Innenstadt nun bis zu 200 Sensoren angebracht werden, die auf Basis von anonymisierten Handydaten messen können, wo sich wie viele Menschen aufhalten und in welche Richtung sie strömen. mehr...
Gelsenkirchen: Besucherströme steuern
[14.02.2025] Im Rahmen des Projekts GE sichert entwickelt die Stadt Gelsenkirchen ein innovatives Konzept zur anonymisierten Bewegungsdatenerfassung und -prognose. Die videobasierte Sensorik kam unter anderem während der EM-Spiele 2024 zum Einsatz. mehr...
Smart City Steckbriefe: Eine Quelle der Inspiration
[10.02.2025] Wie strukturierte Steckbriefe Kommunen als Inspiration für eigene Smart-City-Projekte dienen können, erläutert Chantal Schöpp von der Agentur Creative Climate Cities, die als Partnerin der KTS für das Projekt verantwortlich zeichnet. mehr...
Forschung: Mit Daten Barrieren im ÖPV überwinden
[10.02.2025] Das Forschungsprojekt OPENER next kombiniert moderne Datenanalyse und bürgerschaftliches Engagement. Ziel ist es, die Barrierefreiheit im öffentlichen Personenverkehr (ÖPV) digital zu verbessern. mehr...
Wuppertal: Datenplattform gestartet
[05.02.2025] Die neue Plattform DigiTal Daten der Stadt Wuppertal liefert Echtzeitinformationen aus der Stadt und ist Teil des Modellprojekts Smart City. Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, Feedback zu dem ersten Prototyp zu geben. mehr...
Wiesbaden: Experimentierraum für Digitalprojekte
[04.02.2025] Mit dem Zukunftswerk hat die Stadt Wiesbaden jetzt einen innovativen Experimentierraum eröffnet, der unter dem Motto Stadtlabor2Go die Prinzipien von Bürgerbeteiligung, Nachhaltigkeit und Smart City vereint. mehr...
Saarbrücken: Dashboard für die Smart City
[04.02.2025] Die Stadt Saarbrücken hat ihr Smart City Dashboard veröffentlicht. Das Digitalisierungsdezernat hat dabei auf Open-Source-Technologie gesetzt und den Open-Data-Ansatz verfolgt. Entwickelt wurde das Dashboard von einem Start-up. mehr...
Kreis Recklinghausen: Info-Plattform zum Smart-City-Ansatz
[03.02.2025] Eine Informationsplattform zur regionalen Digitalisierungsstrategie haben der Kreis Recklinghausen und die zehn kreisangehörigen Städte online geschaltet. Das Portal stellt die fünf Handlungsfelder und unterschiedlichen Projekte rund um den Smart-City-Ansatz vor und listet Neuigkeiten und Veranstaltungshinweise auf. mehr...
Kreis Bergstraße: Straßenzustand KI-gestützt erfassen
[30.01.2025] Der Kreis Bergstraße erfasst im Zuge eines Smart-Region-Vorhabens den Straßenzustand besonders effizient: Müllfahrzeuge filmen per Smartphone die Straßen, eine KI wertet die erfassten Daten aus. Diese werden dann den kreisangehörigen Kommunen zur Verfügung gestellt. mehr...
Stuttgart: Smart-City-Projekte im Blick
[30.01.2025] Die Stadt Stuttgart präsentiert die Fortschritte ihrer Digitalisierungsprojekte fortan gebündelt in einem Digitalmonitor. Das an die Öffentlichkeit gerichtete Onlineportal soll zeigen, was bereits erreicht wurde und wie die Stadt mittels digitaler Lösungen zukunftsfähig wird. mehr...
Baden-Württemberg: Klimaatlas ist online
[27.01.2025] Um gezielt auf den Klimawandel zu reagieren, liefert der Klimaatlas Baden-Württemberg Kommunen eine umfassende Datengrundlage. Mit lokalisierten Klimaprofilen und Planungshinweisen, etwa zu Hitzebelastungen, unterstützt er Vorsorge und Anpassungsmaßnahmen vor Ort. mehr...
Hessen: Digitale Zukunft im ländlichen Raum
[22.01.2025] Die Digitalisierung bietet auch Kommunen im ländlichen Raum Chancen, um Lebensqualität, Nachhaltigkeit und Effizienz zu verbessern. Dies zeigen verschiedene Projekte aus Hessen, bei denen vernetzte Sensoren und Datendashboards zum Einsatz kommen. mehr...
Modellprojekte Smart Cities: 19. Regionalkonferenz in Osnabrück
[20.01.2025] Osnabrück lädt am 5. Februar zur 19. Regionalkonferenz der Modellprojekte Smart Cities ein. Zentrales Thema ist die energieeffiziente Kommune. Es soll gezeigt werden, wie mit den Werkzeugen der Smart City Energie gespart, Mobilität intelligent geplant oder die Ressourcenverteilung geschickt ausgestaltet werden kann. mehr...