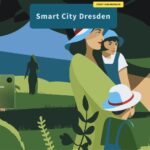UlmDigitalisierung im Quartier

Ulm erprobt digitale Lösungen für die Stadt von morgen.
(Bildquelle: Mirjam Claus/stock.adobe.com)
Im Zuge der digitalen Transformation werden in den Städten die Karten neu gemischt. Das gilt für die Lebensqualität, die Standortpolitik sowie die Stadtentwicklung. Für Ulm geht es dabei nicht nur um den Aufbau von Infrastrukturen und smarte Anwendungen, sondern auch um eine gesamtgesellschaftliche Betrachtung. Die digitale Stadtentwicklung ist ein Treiber für die Standortfaktoren Wirtschaft und Arbeit, forciert die Verwaltungsmodernisierung in Richtung Nutzer- und Querschnittsorientierung sowie Lösungskompetenz und stärkt die Zivilgesellschaft. In Ulm wird der Ansatz „Digitalisierung von unten“ genannt und setzt auf einen starken Einbezug der Stadtgesellschaft. Die Grundsätze lauten: offen, für alle, clever und nachhaltig.
Im Projekt Zukunftskommune@bw, das im Rahmen des gleichnamigen Wettbewerbs vom Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg gefördert wird, erprobt Ulm den Nutzen digitaler Lösungen für die Stadt von morgen. Erlebbar gemacht wird das im Quartier am Alten Eselsberg. Basierend auf den Ergebnissen eines Beteiligungsprozesses, in dem die Ideen und Bedürfnisse der Menschen im Quartier abgefragt wurden, hat der Ulmer Gemeinderat zwölf digitale Projektideen zur Umsetzung beschlossen.
Breiter Einbezug der Bürgerschaft
Übergeordnetes Ziel ist die Entwicklung einer offenen und zentralen Datenplattform als neue Basisinfrastruktur. Das Projekt läuft von Oktober 2018 bis Dezember 2021 und wird von der Geschäftsstelle Digitale Agenda der Stadt Ulm geleitet. Das Unternehmen City & Bits unterstützt die Kommune bei der Projektsteuerung. Auch findet eine universitäre Begleitforschung zu Themenschwerpunkten wie der crossfunktionalen Zusammenarbeit statt. Um ein agiles Erproben digitaler Wege zu ermöglichen, wird ein quartiersbezogener Ansatz verfolgt und auf einen breiten Einbezug der Bürgerschaft gesetzt – von der Ideenfindung bis hin zur Realisierung. Dabei wird prototypisch vorgegangen, die Projekte werden also schrittweise umgesetzt und durch Feedback-Schleifen bürgernah gestaltet. Lösungen können auf diese Weise erprobt, evaluiert und schließlich auf andere Quartiere übertragen werden.
Das Projektgebiet Alter Eselsberg gestaltet sich hinsichtlich seiner 8.700 Bewohnerinnen und Bewohner sowie des Städtebaus recht heterogen. Im Nordwesten von Ulm trifft das größte Neubauareal der Stadt – Am Weinberg – auf die gewachsenen Strukturen des Alten Eselsbergs. Insgesamt gliedert sich das Projekt in vier Handlungsfelder, in denen digitale Projekte bearbeitet werden sowie ein fünftes Handlungsfeld zur Datenplattform. Schon jetzt können am Eselsberg zahlreiche Umsetzungsprojekte begutachtet werden. Das Balkonphotovoltaik-Projekt etwa ermöglicht es den Bewohnern, an der Energiewende teilzuhaben. Erste Wohnblöcke sind bereits ausgestattet und der selbst erzeugte Strom wird genutzt. Ein besonderer Projekterfolg ist, dass das Antragsverfahren in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Ulm vereinfacht wurde.
Querschnittsorientierte Strukturen
Des Weiteren wurde gemeinsam mit dem Verein „engagiert in ulm“ sowie dem Quartiersmanagement am Eselsberg eine neue Datenbank für ehrenamtliches Kurzzeitengagement aufgebaut. Dort können Interessierte Möglichkeiten zum Mitmachen entdecken oder sich benachrichtigen lassen, wenn ein passendes Angebot eingeht. Im Bereich Mobilität entsteht der Pilot einer Mobilitätsstation. Hier sollen Erfahrungen mit Carsharing, E-Ladesäulen und dem Entleihen von E-Lastenrädern gesammelt werden. Im Bereich Handel wurde in einer Testphase ein Online-Wochenmarkt erprobt: Das Start-up mein-wochenmarkt.online lieferte frische Waren per E-Lastenrad und E-Transporter an die Wohnungstür.
Für die ganzheitliche Betrachtung von Herausforderungen und Lösungen im Quartier ist das Zusammenfließen der Kompetenzen verschiedener Abteilungen zentral. Querschnittsorientierte Strukturen fördern den Austausch innerhalb der Fachbereiche und über Projektgrenzen hinweg, schaffen Synergien und ermöglichen es, Konflikte frühzeitig zu antizipieren. In Ulm wurden daher verschiedene Quartiersentwicklungsprojekte verknüpft: das Digitalisierungsprojekt Zukunftskommune@bw, das Förderprojekt Inklusiver Alter Eselsberg, das im Rahmen von Quartier 2020 – Gemeinsam. Gestalten vom Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg gefördert wird sowie die Entwicklung des Neubaugebiets Am Weinberg. Im Jahr 2018 wurde eine Koordinierungsgruppe eingerichtet, um die Projektaktivitäten mit ihren unterschiedlichen Organisationsstrukturen und Zeitläufen aufeinander abzustimmen. Entstanden ist eine Gruppe aus Akteuren der Fachbereiche Bildung und Soziales, Stadtentwicklung, Bau und Umwelt sowie der Digitalen Agenda.
Daten sind das neue Grundwasser
Für die Stadt Ulm sind Daten das neue Grundwasser. Daher wird eine urbane Datenplattform, der Datenhub Ulm, aufgebaut. Er soll die bestehenden Datensilos verknüpfen und als Hafen für sensorbasierte Echtzeitdaten dienen. Die intelligente Bündelung von Daten ist entscheidend, um neue digitale Services zu ermöglichen. Standards zur Bereitstellung und zum Umgang mit Daten sind wichtig, um Datensicherheit und -ethik umzusetzen. Auf Basis dieser Ulmer Smart-City-Plattform sollen dann nutzerzentrierte Anwendungen entwickelt werden, die das Leben der Stadtgesellschaft verbessern. Neben der Funktion, Daten zu speichern und sie den Nutzern kontrolliert, also rollenbasiert, zur Verfügung zu stellen, soll die Möglichkeit zur Datenauswertung mithilfe von Drittanwendungen bestehen, die dann wiederum über die Plattform zugänglich gemacht werden können. Gemäß dem Open-Data-Grundsatz soll ein Zugang für Verwaltung, Bürgerschaft, Wissenschaft und Wirtschaft zu öffentlichen Daten entstehen. Zentral sind Datensouveränität und Transparenz. Der Aufbau des Datenhub wird durch die Zeppelin Universität Friedrichshafen wissenschaftlich begleitet.
Im Projekt Zukunftskommune@bw und im Quartier Alter Eselsberg wird die Blaupause für eine quartiersorientierte Digitalisierung entwickelt und sukzessive auf andere Quartiere übertragen. Das gilt für die Projekte, die Erkenntnisse und die Methoden der Projektarbeit. Diese reichen von den Herausforderungen im Quartier über die Entwicklung datenbasierter Services bis hin zur Einbeziehung der Bürgerschaft. Als Smart-City-Modellstadt des Bundes führt Ulm Erfahrungen aus den Quartieren im Projekt Ulm4CleverCity zusammen. Außerdem wird der Datenhub Ulm kontinuierlich zum urbanen Datenraum weiterentwickelt.
https://www.digital-bw.de/-/digitale-zukunftskommune-bw
https://www.cityandbits.de
Dieser Beitrag ist im Titel der Ausgabe August 2021 von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.
Duisburg: Smart City sucht Bürgerideen
[17.04.2025] Ihren Smart-City-Masterplan will die Stadt Duisburgs gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickeln. Noch bis Ende Mai können diese ihre Ideen online einbringen. Die Stadt will alle Vorschläge sichten, bewerten und, sofern möglich, in den neuen Masterplan einbringen. mehr...
Stuttgart: Smart-City-Masterplan in Arbeit
[16.04.2025] Unter Beteiligung der Stadtgesellschaft erarbeitet Stuttgart einen umfassenden Smart-City-Masterplan. In Workshops diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft entsprechende Ideen und Projekte. Online können außerdem Vorhaben bewertet und kommentiert werden. mehr...
Leipzig / Landau in der Pfalz: Modellstädte für KI-gestützte Verkehrssteuerung
[15.04.2025] Die Städte Leipzig und Landau in der Pfalz werden als Pilotregionen im Forschungsprojekt AIAMO (Artificial Intelligence And MObility) an der KI-gestützten Verkehrssteuerung arbeiten. Die Ergebnisse sollen auf kleine und mittlere Kommunen übertragbar sein. mehr...
Regionalkonferenz MPSC: Smart sein
[11.04.2025] Wie Städte digital und nachhaltig wachsen können, steht im Mittelpunkt der 22. Regionalkonferenz des Bundesprogramms Modellprojekte Smart Cities am 3. Juni 2025 in Halle (Saale). mehr...
Interkommunale Zusammenarbeit: Smarte Daten helfen Bauhöfen
[11.04.2025] Daten aus Sensoren und eine App unterstützen die Orte Nauheim, Trebur und Büttelborn dabei, Baumbewässerung und Streueinsätze gezielt zu planen und künftig auch die Beleuchtung bedarfsabhängig zu steuern. Die Kommunen haben das Projekt gemeinsam umgesetzt. mehr...
Digitale Verkehrssteuerung: KIMONO sorgt für Neustart
[10.04.2025] Kaiserslautern hat seiner verkehrstechnischen Infrastruktur bis 2033 eine umfassende Modernisierung und Digitalisierung verordnet. Von den im Rahmen des Projekts KIMONO entstehenden Lösungen können auch andere Kommunen profitieren. mehr...
Hamburg: Parkraum effizient prüfen
[09.04.2025] In Hamburg können Parkberechtigungen digital beantragt und von den Kontrollkräften online überprüft werden. In Zukunft sollen Scan-Fahrzeuge für noch mehr Effizienz bei der Parkraumkontrolle sorgen – vorausgesetzt, die rechtliche Grundlage wird geschaffen. mehr...
Kreis Hameln-Pyrmont: Smart City geht in Verlängerung
[09.04.2025] Der als Modellprojekt Smart Cities geförderte Kreis Hameln-Pyrmont hat die kostenneutrale Verlängerung der Projektlaufzeit um ein Jahr beantragt – mit Erfolg. Durch den zeitintensiven Abstimmungsbedarf wäre der ursprünglich vorgesehene Zeitraum bis Ende 2026 zu kurz für die Kommune gewesen. mehr...
Interkommunales Netzwerk: Mobiler in der Ortenau
[08.04.2025] Das Mobilitätsnetzwerk Ortenau setzt auf nachhaltige Verkehrslösungen und will die analoge sowie digitale Verkehrsinfrastruktur verbessern. Wie die 14 Kommunen vorgehen, erläutert Sarah Berberich, Geschäftsführerin des Beratungsunternehmens endura kommunal. mehr...
Wolfsburg: Mehr als ein Parkleitsystem
[07.04.2025] Die Stadt Wolfsburg plant – ergänzend zu den Informationen, die sie per App übermittelt – ein dynamisches Parkleitsystem in der Innenstadt. Dieses soll eine effiziente Verkehrssteuerung ermöglichen und darüber hinausgehende Informationen liefern, etwa zu Veranstaltungen. mehr...
Fraunhofer FOKUS: Digital Twin hilft beim Routing
[02.04.2025] Das Smart-Mobility-Team von Fraunhofer FOKUS hat im Projekt KIS’M eine Fahrrad-App entwickelt, die auf einem digitalen Zwilling des Berliner Straßenverkehrs basiert. Die App berücksichtigt individuelle Präferenzen bei der Routenplanung und bietet einen Ampelphasenassistenten. mehr...
Local Digital Twins Toolbox: EU-Projekt für Kommunen
[31.03.2025] Mit der Local Digital Twins Toolbox unterstützt die Europäische Kommission Kommunen bei der Einführung entsprechender Lösungen. Teilnehmende Städte und Gemeinden bekommen wichtige Werkzeuge an die Hand und werden individuell beraten. mehr...
Dresden: Website zu Smart-City-Projekten
[31.03.2025] Eine neue Website mit Informationen zu ihren Smart-City-Projekten hat die Stadt Dresden jetzt online gestellt. Zu den momentan 17 geförderten Vorhaben zählen unter anderem die Entwicklung eines interaktiven 3D-Stadtmodells und ein Testfeld für zukunftsfähige Verkehrsstrukturen. mehr...
Landkreis Wunsiedel: Digitaler Zwilling im Aufbau
[31.03.2025] Der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge soll einen Digitalen Zwilling bekommen. Die Ausschreibung für die Anschaffung der nötigen LoRaWAN-Technologie ist bereits gestartet. Erste Anwendungen sollen noch in diesem Jahr in Betrieb gehen, insbesondere im Bereich Katastrophenschutz. mehr...
Troisdorf: Mit der smarT:app die Freizeit gestalten
[28.03.2025] Die smarT:app der Stadt Troisdorf unterstützt Nutzende mit einer interaktiven Karte jetzt auch bei der Freizeitgestaltung. mehr...