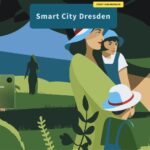Smart CityEine Frage der Technologie

Low-Power-Netzwerke sind eine energiesparende Funktechnologie für Smart Cities.
(Bildquelle: WrightStudio/stock.adobe.com)
Ein Team der Technischen Universität München (TUM) rund um Professor Joachim Henkel hat im Frühjahr 2022 eine Online-Umfrage unter 115 Expertinnen und Experten aus 107 deutschen Städten durchgeführt. Die Teilnehmenden der Studie „Smart Cities in Deutschland 2022 – Technologien, Anwendungsfälle und Partizipation“ gaben dabei unter anderem Auskunft über die Einbindung der Bürgerschaft im Rahmen von Smart-City-Projekten, bereits umgesetzte Vorhaben und die Motivation für ihr Engagement.
Im Rahmen der Befragung interessierte sich das Team insbesondere für die von den befragten Kommunen eingesetzten Low-Power-Wide-Area(LPWA-)Funktechnologien, handelt es sich hierbei doch um eine besonders energiesparende Sensorik, die oft über mehrere Jahre hinweg mit einer Batterie betrieben werden kann. Die kleinen Datenpakete, die über die LPWA-Netzwerke gesendet werden können, sind völlig ausreichend für viele Anwendungen, die nicht auf Echtzeitdaten angewiesen sind. Städte setzen solche LPWA-Netzwerke etwa zur Umweltüberwachung oder im Gebäude-Management ein. Unter den an der Befragung teilnehmenden Kommunen finden sich überwiegend Städte in der Größenordnung von 20.000 bis 100.000 Einwohnern (66 Prozent), ansonsten Großstädte und zwei Kleinstädte. Die meisten der befragten Kommunen haben ihr Smart-City-Engagement dabei erst nach 2016 begonnen und nur etwa die Hälfte von ihnen erhielt dafür finanzielle Förderung.
LoRaWAN hoch im Kurs
Laut der Umfrage kommen in der Smart City verschiedene Kommunikationstechnologien zum Einsatz: Neben klassischem WLAN (72 Prozent) erfreuen sich Mobilfunknetze wie LTE oder 5G (49 Prozent) sowie auch die erwähnten LPWAs (50 Prozent) recht hoher Beliebtheit bei Kommunen jeder Größenordnung. Während WLAN und Mobilfunk im öffentlichen Diskurs schon länger angekommen sind, finden LPWA-Technologien dort bislang kaum Aufmerksamkeit. Die Studie konzentrierte sich daher darauf, besser zu verstehen, wie umfangreich und in welchen technischen Set-ups LPWA-Technologien heute schon in deutschen Smart Cities eingesetzt werden.
Bei der Auswahl einer passenden LPWA-Technologie stehen für die meisten Städte Hygienekriterien wie IT-Sicherheit und die Verfügbarkeit passender Sensorik im Markt im Vordergrund. Unter den drei wichtigsten Auswahlkriterien findet sich darüber hinaus die Unabhängigkeit von Dritten. Das verweist auf eine bisher in der Technologieauswahl wenig diskutierte Eigenschaft: die digitale Souveränität einer Stadt. Die Bewertung der drei prominentesten LPWA-Technologien LoRaWAN, Sigfox und Narrowband-IoT hinsichtlich des Aspekts „Unabhängigkeit von Dritten“ malt ein eindeutiges Bild: Zwei Drittel der Befragten sehen LoRaWAN hier als besonders passend. Bei allen anderen Kriterien zur Auswahl einer passenden LPWA-Technologie zeigt sich eine große Unsicherheit bei der Bewertung: Rund die Hälfte der Befragten vermag keine der drei Technologien als besonders passend zu benennen. Und wenn doch eine bevorzugte Technologie genannt wird, so handelt es sich hier fast immer um LoRaWAN.
Bürgerbeteiligung ist ausbaufähig
Zu erwarten wäre, dass LoRaWAN dementsprechend auch besonders häufig in der Praxis eingesetzt wird, und das ist in der Tat der Fall: Die Mehrheit, nämlich 72 Prozent, der befragten Städte realisiert die Unabhängigkeit von Dritten mittels eines LoRaWANs, das sie selbst oder die eigenen Stadtwerke betreiben. Nur eine Minderheit (15 Prozent) greift auf einen externen Netzwerkanbieter zurück. Auffallend ist, dass 63 Prozent der Städte parallel ein frei zugängliches Netzwerk, vergleichbar mit kostenfreiem WLAN im öffentlichen Raum, bereitstellen. Nicht selten realisieren Städte dies durch zwei oder mehrere sich überlagernde LoRaWANs. Interviews im Rahmen einer Vorstudie legen nahe, dass Städte für sicherheitskritische Anwendungen im Betrieb, wie zum Beispiel die Lecküberwachung im Fernwärmenetz, ein geschlossenes LoRaWAN nutzen und ein zweites, offenes Netzwerk als Service für die Bürgerschaft und für weniger sicherheitskritische Daten bereitstellen.
Von ihrem Smart-City-Engagement erwarten sich die Städte laut der Umfrage vor allem Reputationsgewinne, eine höhere Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Verbesserung städtischer Abläufe. Obwohl 89 Prozent der Städte also die Bürgerschaft als Zielgruppe von Smart City sieht, informieren bisher nur 41 Prozent diese regelmäßig über ihre Smart-City-Aktivitäten und nur 34 Prozent binden die Bürger aktiv ein, etwa über Hackathons, Ideenwettbewerbe oder Kollaborationen mit lokalen Bildungseinrichtungen. Einige Städte arbeiten zudem mit lokalen IT-affinen Gruppen wie dem The Things Network (19 Prozent), dem Chaos Computer Club (neun Prozent) oder Code for Germany (neun Prozent) zusammen. Dabei treffen die Kommunen hier nicht nur auf IT-affine Bürgerinnen und Bürger mit häufig sehr großem Know-how, sondern es können aus einer solchen Zusammenarbeit auch lokal sinnvolle Anwendungen wie Hochwasserfrühwarnsysteme durch Wasserstandsmonitoring hervorgehen.
Kooperationen erleichtern die Umsetzung
Des Weiteren gaben in der Umfrage zahlreiche Städte an, dass ihnen eine offene Infrastruktur und der Bürgerschaft offen zugängliche Sensordaten sehr wichtig sind. Damit drängen sich sofort Anschlussfragen auf, die es zeitnah auszuloten gilt: Welche Daten können wie aufbereitet zur Verfügung gestellt werden? Welchen Zielgruppen werden sie bereitgestellt? Und wie kann die Stadt die erforderliche Datenqualität erreichen? Natürlich müssen die IT-Sicherheit der Stadtverwaltung und der Datenschutz dabei stets gewährleistet sein. Gerade angesichts dieser Mammutaufgabe sind Kooperationen und ein gemeinsames Konzept für Open Data in deutschen Smart Cities notwendig.
Die Tendenz geht also zur offenen Smart City – bei Daten wie bei der Infrastruktur. Und auch die Bürgerschaft soll stärker eingebunden werden. Die Richtung ist klar, anders sieht es beim konkreten Umsetzungsplan aus: Er ist noch vage und wird maßgeblich vom Austausch, dem Wissenstransfer und der Weiterentwicklung in den Städte abhängen. Ein Blick über die Landesgrenzen hinweg zeigt, dass die meisten deutschen Städte deutlich später als die internationalen Vorbilder in Richtung Smart City gestartet sind. Dabei gibt es gute Gründe dafür, sich auf den Weg zu machen: International beschleunigen viele Städte mithilfe von Smart-City-Aktivitäten die Verkehrswende, verbessern die Luftqualität und werden zudem als höchst innovativ und sehr bürgerfreundlich wahrgenommen. Den eingeschlagenen Weg weiterzugehen ist für deutsche Städte eine große Chance, und LPWA-Netzwerke erlauben es ihnen, verschiedene Anwendungsfälle kostengünstig umzusetzen.
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe März 2023 von Kommune21 im Schwerpunkt Smart City erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.
Duisburg: Smart City sucht Bürgerideen
[17.04.2025] Ihren Smart-City-Masterplan will die Stadt Duisburgs gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickeln. Noch bis Ende Mai können diese ihre Ideen online einbringen. Die Stadt will alle Vorschläge sichten, bewerten und, sofern möglich, in den neuen Masterplan einbringen. mehr...
Stuttgart: Smart-City-Masterplan in Arbeit
[16.04.2025] Unter Beteiligung der Stadtgesellschaft erarbeitet Stuttgart einen umfassenden Smart-City-Masterplan. In Workshops diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft entsprechende Ideen und Projekte. Online können außerdem Vorhaben bewertet und kommentiert werden. mehr...
Leipzig / Landau in der Pfalz: Modellstädte für KI-gestützte Verkehrssteuerung
[15.04.2025] Die Städte Leipzig und Landau in der Pfalz werden als Pilotregionen im Forschungsprojekt AIAMO (Artificial Intelligence And MObility) an der KI-gestützten Verkehrssteuerung arbeiten. Die Ergebnisse sollen auf kleine und mittlere Kommunen übertragbar sein. mehr...
Regionalkonferenz MPSC: Smart sein
[11.04.2025] Wie Städte digital und nachhaltig wachsen können, steht im Mittelpunkt der 22. Regionalkonferenz des Bundesprogramms Modellprojekte Smart Cities am 3. Juni 2025 in Halle (Saale). mehr...
Interkommunale Zusammenarbeit: Smarte Daten helfen Bauhöfen
[11.04.2025] Daten aus Sensoren und eine App unterstützen die Orte Nauheim, Trebur und Büttelborn dabei, Baumbewässerung und Streueinsätze gezielt zu planen und künftig auch die Beleuchtung bedarfsabhängig zu steuern. Die Kommunen haben das Projekt gemeinsam umgesetzt. mehr...
Digitale Verkehrssteuerung: KIMONO sorgt für Neustart
[10.04.2025] Kaiserslautern hat seiner verkehrstechnischen Infrastruktur bis 2033 eine umfassende Modernisierung und Digitalisierung verordnet. Von den im Rahmen des Projekts KIMONO entstehenden Lösungen können auch andere Kommunen profitieren. mehr...
Hamburg: Parkraum effizient prüfen
[09.04.2025] In Hamburg können Parkberechtigungen digital beantragt und von den Kontrollkräften online überprüft werden. In Zukunft sollen Scan-Fahrzeuge für noch mehr Effizienz bei der Parkraumkontrolle sorgen – vorausgesetzt, die rechtliche Grundlage wird geschaffen. mehr...
Kreis Hameln-Pyrmont: Smart City geht in Verlängerung
[09.04.2025] Der als Modellprojekt Smart Cities geförderte Kreis Hameln-Pyrmont hat die kostenneutrale Verlängerung der Projektlaufzeit um ein Jahr beantragt – mit Erfolg. Durch den zeitintensiven Abstimmungsbedarf wäre der ursprünglich vorgesehene Zeitraum bis Ende 2026 zu kurz für die Kommune gewesen. mehr...
Interkommunales Netzwerk: Mobiler in der Ortenau
[08.04.2025] Das Mobilitätsnetzwerk Ortenau setzt auf nachhaltige Verkehrslösungen und will die analoge sowie digitale Verkehrsinfrastruktur verbessern. Wie die 14 Kommunen vorgehen, erläutert Sarah Berberich, Geschäftsführerin des Beratungsunternehmens endura kommunal. mehr...
Wolfsburg: Mehr als ein Parkleitsystem
[07.04.2025] Die Stadt Wolfsburg plant – ergänzend zu den Informationen, die sie per App übermittelt – ein dynamisches Parkleitsystem in der Innenstadt. Dieses soll eine effiziente Verkehrssteuerung ermöglichen und darüber hinausgehende Informationen liefern, etwa zu Veranstaltungen. mehr...
Fraunhofer FOKUS: Digital Twin hilft beim Routing
[02.04.2025] Das Smart-Mobility-Team von Fraunhofer FOKUS hat im Projekt KIS’M eine Fahrrad-App entwickelt, die auf einem digitalen Zwilling des Berliner Straßenverkehrs basiert. Die App berücksichtigt individuelle Präferenzen bei der Routenplanung und bietet einen Ampelphasenassistenten. mehr...
Local Digital Twins Toolbox: EU-Projekt für Kommunen
[31.03.2025] Mit der Local Digital Twins Toolbox unterstützt die Europäische Kommission Kommunen bei der Einführung entsprechender Lösungen. Teilnehmende Städte und Gemeinden bekommen wichtige Werkzeuge an die Hand und werden individuell beraten. mehr...
Dresden: Website zu Smart-City-Projekten
[31.03.2025] Eine neue Website mit Informationen zu ihren Smart-City-Projekten hat die Stadt Dresden jetzt online gestellt. Zu den momentan 17 geförderten Vorhaben zählen unter anderem die Entwicklung eines interaktiven 3D-Stadtmodells und ein Testfeld für zukunftsfähige Verkehrsstrukturen. mehr...
Landkreis Wunsiedel: Digitaler Zwilling im Aufbau
[31.03.2025] Der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge soll einen Digitalen Zwilling bekommen. Die Ausschreibung für die Anschaffung der nötigen LoRaWAN-Technologie ist bereits gestartet. Erste Anwendungen sollen noch in diesem Jahr in Betrieb gehen, insbesondere im Bereich Katastrophenschutz. mehr...
Troisdorf: Mit der smarT:app die Freizeit gestalten
[28.03.2025] Die smarT:app der Stadt Troisdorf unterstützt Nutzende mit einer interaktiven Karte jetzt auch bei der Freizeitgestaltung. mehr...