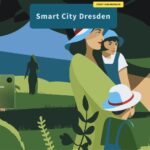Smart City SteckbriefeEine Quelle der Inspiration

Chantal Schöpp und Konrad Traupe, Projektleiter der Zukunftsschusterei der Stadt Bad Belzig, betrachten auf dem 4. Kongress der Modellprojekte Smart Cities im April 2024 in Leipzig den Steckbrief zur Bad Belzig App.
(Bildquelle: DLR)
Frau Schöpp, ein zentraler Auftrag der Koordinierungs- und Transferstelle Modellprojekte Smart Cities (KTS) ist es, die Übertragbarkeit der Maßnahmen aus den vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) geförderten Modellprojekten auf andere Städte zu unterstützen. Strukturierte Steckbriefe – die so genannten Smart City Lösungen – sollen dabei helfen. Welche Erkenntnisse können Kommunen daraus ziehen?
Die Smart City Lösungen bieten Kommunen eine einzigartige Möglichkeit, sich von erfolgreichen Maßnahmen anderer Städte und Regionen inspirieren zu lassen. Die Steckbriefe stellen detailliert dar, wie verschiedene Kommunen digitale Lösungen für urbane Herausforderungen einer integrierten nachhaltigen Stadtentwicklung in Bereichen wie Mobilität, Klimaschutz oder soziale Inklusion erfolgreich einsetzen. Sie ermöglichen einen direkten Einblick in den Umfang, die Einsatzbereiche und in Aspekte, die zu einer erfolgreichen Umsetzung und Verstetigung beitragen. Die Datenbank wird sukzessive erweitert. Die Themen der vorgestellten Lösungen reichen von Beteiligungstools über Klimasensorik bis hin zu virtuellen Spaziergängen.
Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?
Gerne – beispielsweise spielt die Bewässerung öffentlicher Grünflächen eine zentrale Rolle für die Umwelt und das Wohlbefinden in vielen Städten. Gleichzeitig müssen Kommunen dabei Herausforderungen wie Wasserknappheit und hohe Kosten bewältigen. Die Stadt Hannover hat mit dem „Hitze.Wasser.Management“ eine smarte Lösung gefunden, die wir in einem Steckbrief umfassend dokumentiert haben. Dieser enthält Prozessschritte zur Umsetzung, zu erforderlichen Datengrundlagen und technischen Infrastrukturen. Die Steckbriefe liefern also nicht nur neue Ideen, sondern helfen auch, realistisch einzuschätzen, was in welchem Rahmen umsetzbar ist. Die Bündelung der Lösungen an einem Ort macht es leicht, auf einen Blick zu erkennen, welche Ansätze besonders gut für die eigenen kommunalen Bedürfnisse geeignet sind. Mit der kontinuierlich wachsenden Datenbank möchten wir Kommunen in ganz Deutschland einen Überblick über erfolgreich umgesetzte Smart-City-Lösungen bieten. Technologieanbieter und Entwickler profitieren von den Steckbriefen, indem sie praktische Einblicke in Anforderungen und spezifische Anwendungsbereiche digitaler Produkte erhalten.
Wie unterscheiden sich die Smart City Lösungen von anderen Maßnahmensteckbriefen?
Sie punkten vor allem durch ihre Transparenz und ihren hohen Detailgrad. Sie zeichnen sich insbesondere durch die systematische Erhebung laufender Umsetzungsschritte und die Erfassung von Praxiswissen aus. Diese externe Perspektive erlaubt es, kritische Erfolgsfaktoren zu identifizieren – sei es für die Übertragbarkeit auf andere Kommunen oder die langfristige Verstetigung. Als besonders wertvoll stellt sich die Zusammenarbeit mit den kommunalen Vertreterinnen und Vertretern heraus, die durch strukturierte Interviews nicht nur ihre Erfahrungen teilen, sondern auch Handlungsschritte reflektieren. So können Interessierte beispielsweise nachlesen, welche Server-Voraussetzungen für das integrierte digitale Beteiligungssystem DIPAS aus Hamburg erfüllt sein müssen und wie verschiedene Ämter und Dienstleister für die Lösung zusammengearbeitet haben. Die Smart City Lösungen schaffen also eine transparente Übersicht, die zeigt, wie weit Städte in der Digitalisierung bereits vorangeschritten sind – und welche Schritte andere nachahmen können.
„Nur Lösungen, die sich leicht auf andere Kommunen anwenden lassen, finden ihren Weg in die Datenbank.“
Wie werden die Lösungen ausgewählt?
Die Auswahl basiert auf einer Reihe sorgfältig abgestimmter Kriterien, die in Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) erarbeitet wurden. Wir legen Wert darauf, dass dokumentierte Lösungen bereits umgesetzt sind oder sich in einer fortgeschrittenen Testphase befinden. So stellen wir sicher, dass sie nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch funktionieren. Des Weiteren müssen die Projekte konkrete Beiträge zu stadtentwicklungspolitischen Zielen leisten und auf Open-Source-Software beruhen. Ein entscheidender Aspekt ist auch ihre Übertragbarkeit: Nur Lösungen, die sich leicht auf andere Kommunen anwenden lassen, finden ihren Weg in die Datenbank.
Wie verläuft die Zusammenarbeit mit den Kommunen, um die Erkenntnisse aus der Umsetzung festzuhalten?
Als KTS binden wir die Kommunen von Anfang an aktiv ein. So stellen wir sicher, dass die Informationen korrekt und praxisnah sind. Wir arbeiten eng mit den Projektverantwortlichen zusammen, um die Herausforderungen und Erfolgsfaktoren jeder Lösung präzise zu dokumentieren. Im Gespräch mit den Kommunen können lokale Herausforderungen und stadtentwicklungspolitische Zielsetzungen reflektiert und festgehalten werden.
Gibt es bereits konkretes Interesse an der Nachahmung von Lösungen?
Es gibt schon jetzt zahlreiche Übertragungsbeispiele der Smart City Lösungen. Aufbauend auf den Leitlinien Datensouveränität der Stadt Mönchengladbach wurde etwa gemeinsam mit der Stadt Krefeld ein interkommunaler Datenethikbeirat gegründet, der die Grundsätze für den Umgang mit städtischen Daten formuliert. Die in Süderbrarup entwickelte digitale Buchungsplattform Biletado für Vereinsräume oder technische Geräte dient als Vorzeigemodell für kleinere Städte. Die Open-Source-Software hinter der Plattform steht interessierten Kommunen direkt zur Übertragung zur Verfügung, ein Nutzerhandbuch begleitet bei der Implementation. Im City Lab Berlin wiederum haben sich Studierende bei einer Summer School von der Maßnahme Leezenflow aus Münster inspirieren lassen: Die Leezenflow-Software kommuniziert mit Ampeln im Stadtraum und macht so den Radverkehr flüssiger und sicherer.
Was hat es mit der multimedialen Ausstellung auf sich, die auf Basis der Smart City Lösungen konzipiert wurde?
Mit interaktiven Elementen wie Videos, Live-Demonstrationen mit AR-Brillen und anschaulichen Grafiken werden hier komplexe Inhalte verständlich und greifbar gemacht. So wollen wir Begeisterung wecken und den Austausch zwischen Kommunalvertreterinnen und -vertretern aktiv fördern. Die Ausstellung hat die KTS bereits erfolgreich auf Veranstaltungen wie den Kongressen der Modellprojekte Smart Cities in Leipzig und Köln sowie auf der Smart Country Convention präsentiert. Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die Steckbriefe zeigen, wie unterschiedlich die Ansätze für Smart-City-Maßnahmen sein können. Und doch haben sie eines gemeinsam – sie alle leisten einen Beitrag zur digitalen Transformation und lösen reale Herausforderungen der Stadtentwicklung.
Duisburg: Smart City sucht Bürgerideen
[17.04.2025] Ihren Smart-City-Masterplan will die Stadt Duisburgs gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickeln. Noch bis Ende Mai können diese ihre Ideen online einbringen. Die Stadt will alle Vorschläge sichten, bewerten und, sofern möglich, in den neuen Masterplan einbringen. mehr...
Stuttgart: Smart-City-Masterplan in Arbeit
[16.04.2025] Unter Beteiligung der Stadtgesellschaft erarbeitet Stuttgart einen umfassenden Smart-City-Masterplan. In Workshops diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft entsprechende Ideen und Projekte. Online können außerdem Vorhaben bewertet und kommentiert werden. mehr...
Leipzig / Landau in der Pfalz: Modellstädte für KI-gestützte Verkehrssteuerung
[15.04.2025] Die Städte Leipzig und Landau in der Pfalz werden als Pilotregionen im Forschungsprojekt AIAMO (Artificial Intelligence And MObility) an der KI-gestützten Verkehrssteuerung arbeiten. Die Ergebnisse sollen auf kleine und mittlere Kommunen übertragbar sein. mehr...
Regionalkonferenz MPSC: Smart sein
[11.04.2025] Wie Städte digital und nachhaltig wachsen können, steht im Mittelpunkt der 22. Regionalkonferenz des Bundesprogramms Modellprojekte Smart Cities am 3. Juni 2025 in Halle (Saale). mehr...
Interkommunale Zusammenarbeit: Smarte Daten helfen Bauhöfen
[11.04.2025] Daten aus Sensoren und eine App unterstützen die Orte Nauheim, Trebur und Büttelborn dabei, Baumbewässerung und Streueinsätze gezielt zu planen und künftig auch die Beleuchtung bedarfsabhängig zu steuern. Die Kommunen haben das Projekt gemeinsam umgesetzt. mehr...
Digitale Verkehrssteuerung: KIMONO sorgt für Neustart
[10.04.2025] Kaiserslautern hat seiner verkehrstechnischen Infrastruktur bis 2033 eine umfassende Modernisierung und Digitalisierung verordnet. Von den im Rahmen des Projekts KIMONO entstehenden Lösungen können auch andere Kommunen profitieren. mehr...
Hamburg: Parkraum effizient prüfen
[09.04.2025] In Hamburg können Parkberechtigungen digital beantragt und von den Kontrollkräften online überprüft werden. In Zukunft sollen Scan-Fahrzeuge für noch mehr Effizienz bei der Parkraumkontrolle sorgen – vorausgesetzt, die rechtliche Grundlage wird geschaffen. mehr...
Kreis Hameln-Pyrmont: Smart City geht in Verlängerung
[09.04.2025] Der als Modellprojekt Smart Cities geförderte Kreis Hameln-Pyrmont hat die kostenneutrale Verlängerung der Projektlaufzeit um ein Jahr beantragt – mit Erfolg. Durch den zeitintensiven Abstimmungsbedarf wäre der ursprünglich vorgesehene Zeitraum bis Ende 2026 zu kurz für die Kommune gewesen. mehr...
Interkommunales Netzwerk: Mobiler in der Ortenau
[08.04.2025] Das Mobilitätsnetzwerk Ortenau setzt auf nachhaltige Verkehrslösungen und will die analoge sowie digitale Verkehrsinfrastruktur verbessern. Wie die 14 Kommunen vorgehen, erläutert Sarah Berberich, Geschäftsführerin des Beratungsunternehmens endura kommunal. mehr...
Wolfsburg: Mehr als ein Parkleitsystem
[07.04.2025] Die Stadt Wolfsburg plant – ergänzend zu den Informationen, die sie per App übermittelt – ein dynamisches Parkleitsystem in der Innenstadt. Dieses soll eine effiziente Verkehrssteuerung ermöglichen und darüber hinausgehende Informationen liefern, etwa zu Veranstaltungen. mehr...
Fraunhofer FOKUS: Digital Twin hilft beim Routing
[02.04.2025] Das Smart-Mobility-Team von Fraunhofer FOKUS hat im Projekt KIS’M eine Fahrrad-App entwickelt, die auf einem digitalen Zwilling des Berliner Straßenverkehrs basiert. Die App berücksichtigt individuelle Präferenzen bei der Routenplanung und bietet einen Ampelphasenassistenten. mehr...
Local Digital Twins Toolbox: EU-Projekt für Kommunen
[31.03.2025] Mit der Local Digital Twins Toolbox unterstützt die Europäische Kommission Kommunen bei der Einführung entsprechender Lösungen. Teilnehmende Städte und Gemeinden bekommen wichtige Werkzeuge an die Hand und werden individuell beraten. mehr...
Dresden: Website zu Smart-City-Projekten
[31.03.2025] Eine neue Website mit Informationen zu ihren Smart-City-Projekten hat die Stadt Dresden jetzt online gestellt. Zu den momentan 17 geförderten Vorhaben zählen unter anderem die Entwicklung eines interaktiven 3D-Stadtmodells und ein Testfeld für zukunftsfähige Verkehrsstrukturen. mehr...
Landkreis Wunsiedel: Digitaler Zwilling im Aufbau
[31.03.2025] Der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge soll einen Digitalen Zwilling bekommen. Die Ausschreibung für die Anschaffung der nötigen LoRaWAN-Technologie ist bereits gestartet. Erste Anwendungen sollen noch in diesem Jahr in Betrieb gehen, insbesondere im Bereich Katastrophenschutz. mehr...
Troisdorf: Mit der smarT:app die Freizeit gestalten
[28.03.2025] Die smarT:app der Stadt Troisdorf unterstützt Nutzende mit einer interaktiven Karte jetzt auch bei der Freizeitgestaltung. mehr...