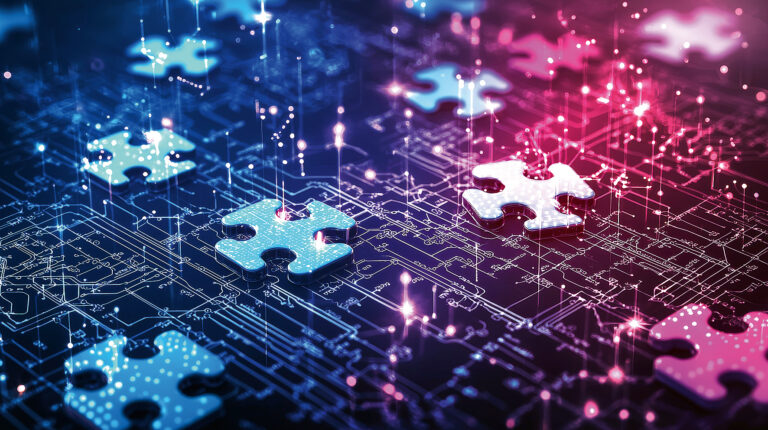AutomatisierungEs geht auch ohne KI
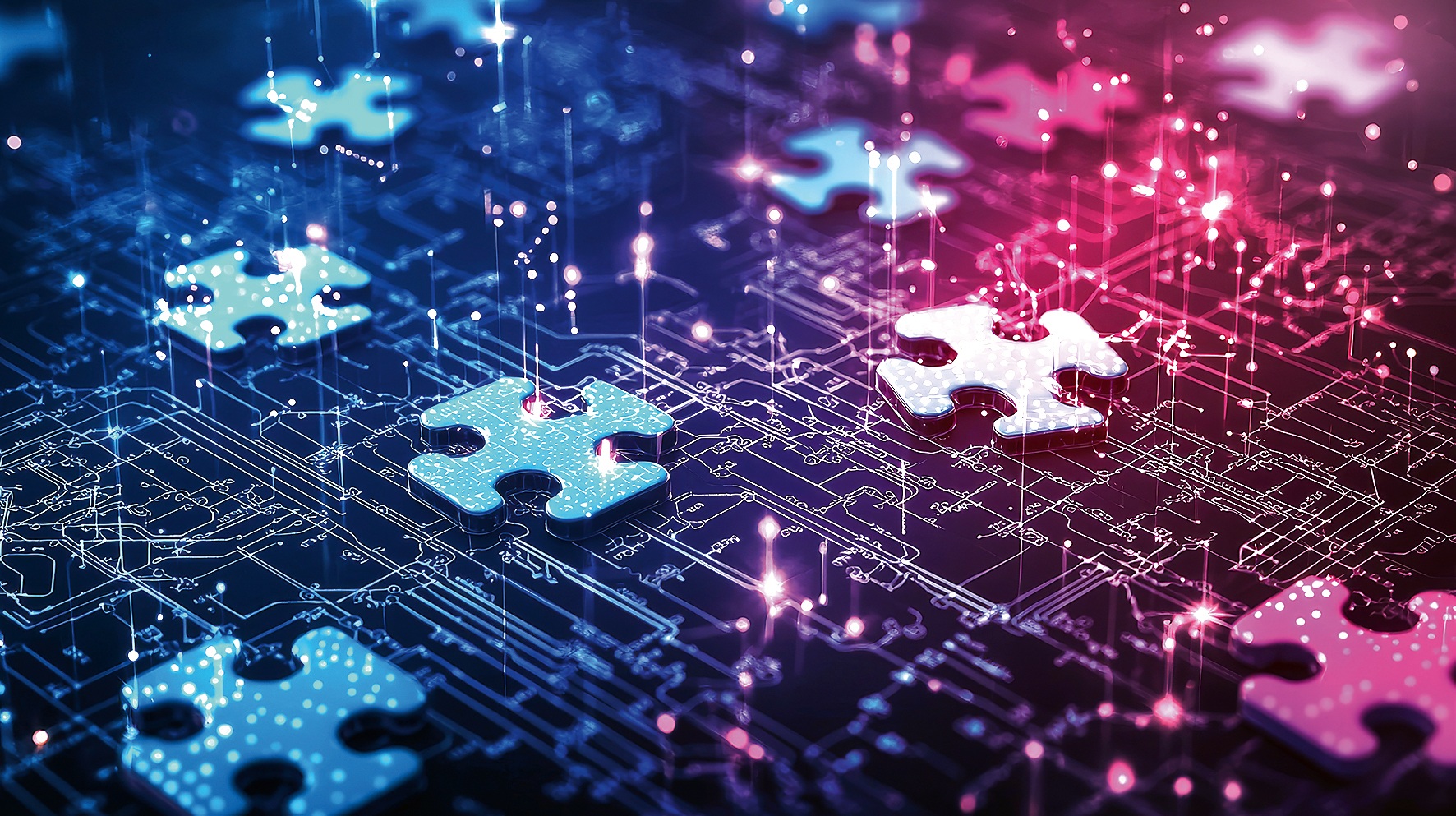
Mit der Registermodernisierung steht und fällt der Digitale Staat.
(Bildquelle: stock.adobe.com/Avve Diana)
Das Land Berlin geht für das Jahr 2024 von rund 130.000 Anträgen für den Anwohnerparkausweis aus. In immer mehr Quartieren der Bundeshauptstadt wird die Vignette für Fahrzeughalter zur Pflicht und muss alle zwei Jahre neu beantragt werden. Das kann online oder postalisch geschehen, und nach einer berlintypischen Bearbeitungszeit von etwa zehn Wochen liegt der Fensteraufkleber dann im heimischen Briefkasten. Im Hintergrund haben Mitarbeitende geprüft, ob der Antragsteller seinen Wohnsitz in Berlin hat, in der gewünschten Parkzone gemeldet ist und ob er ein Kraftfahrzeug auf seinen Namen unterhält. Auch Beschäftigte können unter bestimmten Voraussetzungen Plaketten fürs Parken am Arbeitsplatz beantragen, die noch komplexeren Prüfvorgängen unterliegen. Legt man eine optimistische Bearbeitungszeit von nur fünf Minuten pro Fall an, kommen jährlich rund 1.400 Arbeitstage und etwa sieben Vollzeit-Beschäftigte zusammen, die nichts anderes machen, als Angaben zu prüfen und Autokennzeichen mit einem Filzstift auf Plastikvignetten zu schreiben.
In Aachen, Frankfurt am Main oder Lemgo geschieht dies bereits automatisiert. Dort gibt es komplett digitale Workflows und Onlineverfahren, an deren Ende der heimische Printer die Parkberechtigung ausdruckt. Beantragung und Bezahlung werden am PC erledigt, der Gang zum Amt oder lange Wartezeiten entfallen. Kein Mensch hat einen Blick auf den Prozess geworfen. Auch in der Bundeshauptstadt ist die Onlinebeantragung des Anwohnerparkausweises seit Längerem im Gespräch und nun für 2025 angekündigt. „Den automatisierten Datenabruf aus Melderegister und Zentralem Fahrzeugregister könnte man einfach regeln. Wenn beide Identitäten bei der Maschine-zu-Maschine-Kommunikation nach der einmaligen Registrierung übereinstimmen, dann ist das Fahrzeug im Fachverfahren fürs Anwohnerparken registriert – und fertig“, sagt Dirk Meyer-Claassen, Abteilungsleiter in der Senatskanzlei Berlin. Dafür muss lediglich der Zugriff auf die beiden Register technisch ermöglicht und rechtlich abgesichert werden.
Leicht komplett zu automatisieren
Ob Berlin noch einen Schritt weitergeht und ein Abo-Modell wie beim Deutschlandticket einführt, ist noch nicht geklärt. „Das Abo könnte sich automatisch solange verlängern, wie die Bürger die Parkberechtigung nutzen wollen. Das wäre auch beim Anwohnerparken sinnvoll“, sagt Meyer-Claassen. Vielleicht kommen dann auch Scan-Cars zum Einsatz, die den Berliner Straßenraum auf der Suche nach Parksündern durchmessen. Automatisch registrieren sie die parkenden Fahrzeuge und nehmen einen Abgleich mit den Fachverfahren vor, in denen die Berechtigungen zum Anwohnerparken oder ein zeitlich begrenztes Parkticket hinterlegt sind. Andernfalls droht ein Knöllchen. In der tschechischen Hauptstadt Prag sei ein solches Verfahren bereits im Einsatz, so Dirk Meyer-Claassen: „Auf diese Weise könnte man auch auf die Kontrollgänge durch das Ordnungsamt verzichten. Der Mehrwert wäre besonders groß.“
Das Anwohnerparken ist ein Paradebeispiel für einen Verwaltungsprozess, der sich leicht komplett automatisieren lässt und dadurch einen besonderen Effizienzgewinn verspricht. In Zeiten von Fachkräftemangel und knapper werdender Personaldecke erscheint es wenig sinnvoll, die Mitarbeitenden eintönige Prüfsachen verrichten zu lassen. Würde man mehr automatisieren und maschinell durchführen, könnten die Kapazitäten für anspruchsvollere Tätigkeiten genutzt werden. „Voraussetzung für eine vollständige Automatisierung von Verwaltungsprozessen ist, dass es keinen Ermessensspielraum gibt, sondern eine klare Rechts- und Anspruchsgrundlage“, sagt Jan Ziesing, Leiter des Geschäftsbereichs Digital Public Services beim Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme FOKUS.
Ein Fahrzeughalter mit festem Haupt- oder Nebenwohnsitz hat einen rechtlichen Anspruch auf den Parkausweis an seiner Adresse. Den kann ihm niemand versagen, und insofern muss auch niemand den Prozess beobachten, begleiten oder manuell ausführen. „Die Effizienz durch Automatisierung besteht vor allem darin, dass Menschen und ihre Arbeitskraft aus dem Ring genommen werden. Wenn das deutschlandweit einheitlich geschieht, hat man besonders große Effizienzgewinne“, erklärt Jan Ziesing.
Verwaltung und Antragsteller sparen Zeit
Laut dem Barometer Digitale Verwaltung 2024, einer Umfrage unter Verwaltungsmitarbeitenden, lassen sich 38 Prozent aller Verwaltungstätigkeiten automatisieren. Mit diesem Schätzwert ist das gesamte Digitalisierungspotenzial gemeint – von Dokumentenmanagementsystemen über Prüfassistenzen via Künstlicher Intelligenz bis hin zur Automatisierung von Teilprozessen durch Robotic Process Automation (RPA). Bei RPA können wiederkehrende Aufgaben – wie die Prüfung von Unterlagen auf Vollständigkeit – regelbasiert mittels Software-Bots ausgeführt werden. Grundsätzlich kann dies auch bei komplexen Verwaltungsprozessen eingesetzt werden, die Entscheidungen durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlangen. Oft lassen sich zumindest einige Vorarbeiten, die für die Entscheidungsfindung notwendig sind, automatisieren. Entfällt allerdings ein Ermessensspielraum, ist die Automatisierung umso einfacher.
Wie viel Zeit sich auf diese Weise an beiden Enden, bei der Verwaltung und den Antragstellern, einsparen lässt, verdeutlich das Beispiel der Einmalzahlung der Energiepreispauschale an Studenten und Schüler, die von Bund und Ländern 2022 im Kontext von Inflation und Energiekrise vereinbart wurde. Unter Federführung des Landes Sachsen-Anhalt wurde ein weitgehend automatisierter Prozess aufgesetzt und anderen Bundesländern sowie dem Bund nach dem Einer-für-Alle-Prinzip zur Verfügung gestellt. Zunächst hatten allerdings die 4.500 Ausbildungsstätten Listen mit Berechtigten zu erstellen, insgesamt drei Millionen Studierende und knapp 500.000 Schüler. Die Auszahlung in Höhe von 200 Euro erfolgte dann über eine zentrale Plattform mittels Onlineantrag, Zugangscode und BundID. Ein automatisierter Prüfprozess erlaubte die Abwicklung von bis zu 600.000 Zahlungen pro Tag über die Bundeskasse. Händisch hätte dies wohl Wochen, wenn nicht gar Monate in Anspruch genommen.
Analoge Denkweisen bremsen aus
Das Potenzial der Automatisierung ist noch lange nicht ausgeschöpft. Im Rahmen von Verwaltungsdigitalisierung und Onlinezugangsgesetz ist grundsätzlich ein höheres Bewusstsein für die technische Umsetzbarkeit von digitalen Verwaltungsverfahren entstanden. Seitens der IT gibt es so gut wie keine Hürden. Anders sieht es bei der Fachlichkeit und dem Rechtsrahmen aus. Viele Normen müssen noch an die digitalen Möglichkeiten angepasst werden, und ein digitales Mindset hat sich noch nicht in allen Verwaltungen durchgesetzt.
Das führt dazu, dass ein Verwaltungsprozess wie die Eheschließungsvoranmeldung, für die eine Vielzahl von Dokumenten herbeizubringen ist, wohl so schnell nicht automatisiert werden wird. Auch wenn es dabei gar keinen Ermessensspielraum gibt, sehen die meisten Kommunalverordnungen noch ein persönliches Erscheinen auf dem Standesamt vor – so wie sich die „gefühlte Schriftform“ auch ohne Rechtsgrundlage auf vielen Formularen etabliert hat. Wenn dann einmal im Zuge der Digitalisierung der Onlineausweis die Unterschrift ersetzt hat und das Once-Only-Prinzip im Rahmen der Registermodernisierung die wiederholte Vorlage der immer gleichen Dokumente auf dem Amt unnötig macht, wäre man einen entscheidenden Schritt weiter. Für die Eheschließung würde dies bedeuten, dass der bürokratische Teil sich vorab online verrichten ließe und der romantische Teil dann auf dem Standesamt stattfindet.
Unnötige Bürokratie
Wie sehr auch bei digitalen Prestigeprojekten noch in analogen Kategorien gedacht wird, zeigt die internetbasierte Fahrzeugzulassung (i-Kfz). Vielerorts ist die An-, Um- und Abmeldung eines Fahrzeugs inzwischen online möglich, doch das Prozedere erscheint viel zu kompliziert. Offenbar sind alle Verwaltungsschritte in der analogen Welt beim Onlineprozess digital nachempfunden worden. Dem Ausfräsen der Kennzeichensiegel auf der Zulassungsstelle entspricht das Zerkratzen derselben mit einer Zwei-Euro-Münze am heimischen Schreibtisch. Und der Annullierung der Gültigkeit der Fahrzeugpapiere per Amtsstempel kommt das Wegrubbeln der Sicherheitscodes nahe. Das Gesetz sieht es so vor.
Der gesamte Ablauf bei der internetbasierten Fahrzeugzulassung ließe sich deutlich vereinfachen und nutzerfreundlicher gestalten, wenn auf den Medienbruch durch die Zusendung der Plaketten verzichtet würde. Denn im Grunde bedarf es keiner Plaketten – alle Berechtigungen und Fristen liegen dem Kraftfahrt-Bundesamt digital vor.

(Bildquelle: stock.adobe.com/philipk76)
Solch bürokratischer Aufwand ist dem Nationalen Normenkontrollrat (NKR) seit Langem ein Dorn im Auge. Im vergangenen Jahr ist ein Gutachten mit dem Titel „Wege aus der Komplexitätsfalle – Vereinfachung und Automatisierung von Sozialleistungen“ erschienen. Am Beispiel der Kindergrundsicherung ist der erhebliche bürokratische Aufwand für die Leistungsberechtigten und die Verwaltung untersucht worden. Das Ergebnis: Der deutsche Sozialstaat ist zu bürokratisch, seine Strukturen und Zuständigkeiten verworren, die Leistungen nicht abgestimmt und intransparent. Zudem sei das Personal in den Behörden viel zu intensiv mit dem Prüfen und gegenseitigen Anrechnen von verschiedenen Ansprüchen beschäftigt. „Mit dem Gutachten zeigen wir, wie gute Automatisierung für einen effizienten Vollzug genutzt werden kann. Wir brauchen verbindliche Standards und einen einheitlichen, digitaltauglichen Rechtsrahmen für alle Sozialleistungen. Damit kann der Aufwand für die Leistungsberechtigten und für die Behörden deutlich reduziert werden“, sagt NKR-Experte Malte Spitz.
Hohe Datenqualität als Grundlage
Voraussetzung für automatisierte Prozesse sind in jedem Fall saubere, strukturierte Daten. „Um eine erfolgreiche Prozessautomatisierung zu ermöglichen, ist eine hohe Datenqualität unerlässlich. Dies erfordert strukturierte Daten aus Fachverfahren, die etwa von Kommunen und ihren IT-Dienstleistern bereitgestellt werden“, sagt Katrin Giebel, Bereichsleiterin beim Verband der kommunalen IT-Dienstleister, Vitako. Giebel macht gleichzeitig auf die Komplexität aufmerksam, wenn Automatisierungsprozesse den Zugriff auf Register erfordern. Hier müssen einheitliche Datenkonzepte und Compliance-Anforderungen gefunden werden, vor allem, wenn Datenanfragen und Datentransport über Ländergrenzen hinweg erfolgen. Auch die Anbindung an das National-Once-Only-Technical-System (NOOTS), das Verbindungsnetz zwischen den einzelnen Verwaltungsregistern, setzt Vereinheitlichung voraus. „Lösungen können nur gemeinsam entwickelt werden. Hierfür benötigt es eine stärkere Zusammenarbeit und ein holistisches Mindset, denn Digitalisierung und Automatisierung können nur vorankommen, wenn sie von der technischen und der fachlichen Ebene gemeinsam entwickelt und umgesetzt werden“, sagt Katrin Giebel.
Registermodernisierung als Gamechanger
Und so hängt die Automatisierung von Verwaltungsprozessen in vielen Fällen vom Vorankommen bei der Registermodernisierung ab. Mit dieser steht und fällt der digitale Staat. Insbesondere kommt es darauf an, zunächst die großen Register fit zu machen: Personen-, Melde- und Handelsregister, aber auch die Steuerregister, auf die besonders häufig zugegriffen wird. Bei ELFE – Einfach Leistungen für Eltern, dem digitalen Prestige-Projekt der Hansestadt Bremen, hakte es lange Zeit aufgrund fehlender rechtlicher Regelungen für den digitalen Zugriff auf Gehaltsinformationen bei den Finanzämtern. Es zeigt sich daran, dass die technische Entwicklung rechtzeitig von der rechtlichen Ermöglichung flankiert werden muss.
Darüber hinaus lässt sich am Beispiel ELFE noch ein weiterer positiver Aspekt der Registermodernisierung aufzeigen: Während Antragsteller bei der Beantragung von Sozialleistungen oftmals aufgefordert werden, einzureichende Urkunden auch noch beglaubigen zu lassen, stellt sich die Frage der Authentizität beim Registerzugriff nicht. „Die Registermodernisierung ist ein Gamechanger, weil staatliche Register per se vertrauenswürdig sind und daher eine händische Prüfung nicht mehr stattfinden muss“, sagt Jan Ziesing. Das spart Zeit auf beiden Seiten, bei Verwaltung und Antragsteller – und diese Zeitersparnis wird immer mehr zum Indikator für den Digitalisierungserfolg.
Essen: Neue Terminlösung hat Erfolg
[17.04.2025] Seit acht Monaten kommt in Essen ein neues Terminmanagementsystem zum Einsatz. Die Lösung wird gut angenommen und verbessert die Abläufe vor Ort. Sukzessive wird sie auf alle termingebundenen Dienstleistungen der Stadt ausgeweitet. mehr...
Kreis Schmalkalden-Meiningen: IT-Infrastruktur zentralisiert
[16.04.2025] Im Kreis Schmalkalden-Meiningen ist der Kommunale IT-Service (KitS) für die IT-Infrastruktur der Kommune, ihrer Schulen und der öffentlichen Unternehmen zuständig. Um dieser Aufgabe besser nachkommen zu können, setzt der KitS nun eine zentralisierende, hyperkonvergente Lösung ein. mehr...
Lüneburg: Abgucken erwünscht
[04.04.2025] Die Hansestadt Lüneburg hat die Anmeldung für Grundschulen digitalisiert. Mit dem Formular-Editor von NOLIS hat sie eigenständig ein Onlineformular entwickelt, das eine digitale Anmeldung an allen Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft ermöglicht. mehr...
Picture / XIMA Media: Schnittstelle vereint Prozesse und Formulare
[31.03.2025] Die Unternehmen Picture und XIMA Media haben eine Schnittstelle zwischen der PICTURE-Prozessplattform und dem Formularsystem formcycle realisiert. Somit können bei der Prozessmodellierung gezielt passende Formulare und Assistenten ausgewählt und mit dem Prozessschritt verknüpft werden. mehr...
SIT/KDVZ/regio iT: Bundestagswahl gemeinsam gemeistert
[04.03.2025] Gemeinsam haben die KDVZ Rhein-Erft-Rur in Frechen, die regio iT in Aachen und die Südwestfalen-IT mit Standorten in Hemer und Siegen für den sicheren technischen Ablauf der Bundestagswahl in ihrem Zuständigkeitsbereich gesorgt. mehr...
Emsdetten: Schritt in die Cloud
[28.02.2025] Sorgfältig vorbereitet hat die Stadt Emsdetten ihre Verwaltungsarbeitsplätze auf Microsoft 365 umgestellt. IT-Dienstleister regio iT hat die Kommune in jeder Phase des Projekts begleitet. mehr...
Nürnberg: Wegweisender IT-Neustart
[27.02.2025] Ihr Hauptrechenzentrum hat die Stadt Nürnberg an einen Dienstleister ausgelagert. Die IT-Infrastruktur wird nun energieeffizient und hochsicher extern betrieben, was der Stadt Aufwand und Kosten spart. mehr...
Lexmark: Portfolio an Drucklösungen erweitert
[10.02.2025] Lexmark hat jetzt sein Angebot an Drucklösungen erweitert und stellt neue KI-gestützte Clouddienste vor. Mit zusätzlichen Modellen der 9er-Serie und einer optimierten Cloudplattform will das Unternehmen mehr Flexibilität und Effizienz bieten. mehr...
Heinlein Gruppe: Open-Source-Cloud für die Verwaltung
[05.02.2025] Die Heinlein Gruppe startet OpenCloud – eine Open-Source-Plattform für DSGVO-konformes File-Management und digitale Kollaboration. Die Lösung will sich als sichere, digital souveräne Alternative zu den großen außereuropäischen Cloud-Service-Anbietern etablieren. mehr...
OWL-IT: Gemeinsam zu Low Code
[03.02.2025] Der kommunale Zweckverband Ostwestfalen-Lippe-IT (OWL-IT) führt gemeinsam mit seinen Verbandskommunen eine Low-Code-Plattform ein und verspricht sich davon viele positive Effekte. Anfang 2025 soll das System für die Kunden zur Verfügung stehen. mehr...
Meßstetten: Notebooks statt Desktop-PCs
[23.01.2025] Die Stadtverwaltung Meßstetten verabschiedet sich von den bislang eingesetzten Desktop-PCs und rüstet fast alle Arbeitsplätze mit einer Dockingstation für Laptops sowie zwei 24-Zoll-Monitoren aus. Die Laptops können nicht nur vor Ort genutzt, sondern beispielsweise auch zu Besprechungen oder Außenterminen mitgenommen werden. mehr...
Hessen: Gemeinsam digitalisieren
[16.01.2025] Im Rahmen einer interkommunalen Kooperation haben vier hessische Gemeinden im Projekt „Digitalisierungsfortschritt Fachverfahren“ zentrale Verwaltungsleistungen digitalisiert. Mit 216.000 Euro Fördermitteln unterstützte das Land diesen Schritt in Richtung moderner Verwaltung. mehr...
Bad Bentheim: Arbeitsplatz in der Cloud
[18.12.2024] Die Stadt Bad Bentheim führt die cloudbasierte Arbeitsplatzlösung Microsoft 365 ein und verspricht sich davon effizientere und flexiblere Abläufe. Unterstützung bei der Einführung erhielt die Kommune durch ihren langjährigen IT-Dienstleister ITEBO. mehr...
Virtuelle Realität: Die Zukunft beginnt jetzt
[27.11.2024] Technologien wie Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) eröffnen auch für Verwaltungen völlig neue Möglichkeiten. Erste Denkanstöße für potenzielle Einsatzgebiete in Kommunen will nun eine Arbeitsgruppe der KGSt erstellen. mehr...