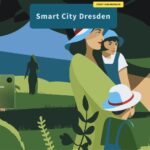Smart CityHerzstück digitaler Infrastruktur

Software AG und SAP realisieren Smart-City-Plattform.
Werner Rieche, Regional President DACH der Software AG, und Susanne Diehm, Leiterin Public & Healthcare sowie Mitglied der Geschäftsleitung von SAP Deutschland
(Bildquelle: SAP)
SAP und Software AG haben auf der Smart Country Convention (20. bis 22. November 2018, Berlin) ihre Kooperation für den Aufbau einer offenen Smart-City-Plattform bekanntgegeben (wir berichteten). Mit ihr sollen Städte, Gemeinden und Landkreise individuelle Smart-City- und Smart-Country-Vorhaben eigenverantwortlich umsetzen und den Bürgern neue intelligente Services anbieten können. Die Plattform kann modular erweitert werden, wenn projektbezogen neue Anforderungen hinzukommen.
Die beiden größten Software-Häuser Deutschlands haben die Lösung eigenen Angaben zufolge in Anlehnung an die Normierungsinitiative DIN SPEC Offene Urbane Plattform 91357 der EU erstellt. Sie umfasse ein abgestimmtes Zusammenspiel von Komponenten aus den Bereichen Internet der Dinge (Internet of Things, IoT), Big Data und künstliche Intelligenz sowie eine Entwicklungsplattform für smarte Apps. Dabei integriere sie bestehende Dateninseln und sei offen für andere Lösungsanbieter – vom kommunalen Betrieb über den IT-Dienstleister bis hin zum Start-up.
Datenkontrolle und Kosteneffizienz
„Zusammen mit SAP werden wir eine zukunftsweisende digitale Plattform für die Kommunen in Deutschland aufbauen“, sagt Werner Rieche, Regional President DACH der Software AG. „Damit können Städte, Gemeinden und kommunale Betriebe den Weg zur vernetzten Verwaltung und zu neuen intelligenten Services gemeinschaftlich und souverän gestalten.“ Susanne Diehm, Leiterin Public & Healthcare sowie Mitglied der Geschäftsleitung von SAP Deutschland, ergänzt: „Smarte Länder und Städte können nur mithilfe einer smarten und offenen Plattform realisiert werden. Die gemeinsame Nutzung unserer Plattform soll allen Mitgliedern der kommunalen Familie ein hohes Maß an Datenkontrolle und Kosteneffizienz garantieren.“
Smarter Winterdienst
Nach Aussage von Susanne Diehm ist die Smart-City-Plattform der richtige Weg für Kommunen, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ein Beispiel dafür war als Showcase auf der Smart Country Convention zu sehen: der smarte Winterdienst. Dabei liefert ein Aufsatz für ein Fahrzeug im Winterdienst relevante Daten rund um den Streudienst über Sensoren in Echtzeit in die Cloud und stellt sie für eine weitere Verarbeitung auf der SAP-HANA-Plattform bereit. Dort werden sie analysiert und greifbar gemacht. So lassen sich die Route des Streufahrzeugs und die Streumengen optimieren. Die Software AG steuert hierfür verschiedene IoT-Services bei, etwa für das Geräte-Management, das Onboarding von Sensoren sowie die Datenübermittlung an die Plattform.
Ganz neue Anwendungsmöglichkeiten
Die Anwendungsmöglichkeiten der Smart-City-Plattform beschränken sich aber selbstverständlich nicht auf den Winterdienst. Wie die Smart-City-Experten Christopher Hönn (Software AG) und Bernd Simon (SAP) gegenüber Kommune21 erläutern, sind grundsätzlich alle Einsatzbereiche denkbar. Insbesondere unterstütze die Plattform die Integration und Auswertung der unterschiedlichsten Daten aus dem kommunalen Umfeld. Klassische Software-Anwendungen können das nach Angaben der Experten nicht leisten, da sie für ganz bestimmte Anwendungsfälle konzipiert sind, etwa die Ampelsteuerung im Stadtverkehr, und nur von bestimmten Organisationen, wie dem Verkehrsreferat, genutzt werden können. „Die Smart-City-Plattform vernetzt diese Einsatzbereiche und bietet somit ganz neue Anwendungsmöglichkeiten, wenn beispielsweise die Ampeln des Verkehrsreferats anhand der aktuellen Luftqualitätsdaten vom Umweltreferat gesteuert werden sollen.“ Da die Plattform offen und skalierbar sei, gebe es von technischer Seite keine Grenzen bei der Vernetzung der unterschiedlichsten kommunalen Daten und Anwendungen.
Neue Form der Kooperation
Im Kern sorgt die Smart City dafür, dass die verschiedenen Stakeholder besser miteinander arbeiten können, sind die Experten von SAP und Software AG überzeugt. Das gelte für Bürger und ortsansässige Unternehmen ebenso wie für die kommunale Verwaltung mit ihren Betrieben und Trägern. „Die digitale Plattform ist nicht der Zweck, aber sie fördert und fordert diese neue Form der Kooperation. So können neue Erkenntnisse in sehr viel kürzerer Zeit und besserer Qualität gewonnen werden.“ Wenn beispielsweise ein neues Konzept für den innerstädtischen Fahrradverkehr mit Radwegen, Verleihstationen, Entschärfung von Unfallschwerpunkten und tageszeit- sowie wetterbedingten Nutzungsschwankungen erarbeitet wird, dann sind daran mehrere Referate über viele Monate hinweg beteiligt. Mit einer Plattform hingegen lassen sich die unterschiedlichsten Datenquellen für komplexe Analysen und Planungsszenarien sofort nutzen, so die Experten.
„Zum anderen wird die Plattform Herzstück der zukünftigen kommunalen digitalen Infrastruktur, die – einmal implementiert – mit vergleichsweise geringen Kosten für neue Teilnehmer erweitert werden kann“, meinen Christopher Hönn und Bernd Simon. Je mehr der zahlreichen kommunalen Akteure die gemeinsame Plattform nutzen, desto effizienter und kostengünstiger werde sie. Das Internet of Things stecke noch in den Kinderschuhen. Immer mehr Sensoren und Aktoren werden in kommunale Fahrzeuge, Maschinen, Gebäude und Straßen eingebaut und erzeugen so eine neue digitale Infrastruktur. In diesem Zusammenhang sei es nach Angaben der Smart-City-Experten wünschenswert, die dafür notwendige IoT-Plattform nur einmal für alle Teilnehmer aufbauen zu müssen anstatt immer wieder neu für jeden einzelnen Teilnehmer.
Kultur des Ausprobierens
Als erfolgsentscheidend auf dem Weg zur Smart City bezeichnen Hönn und Simon klare Ziele, realistische Erwartungen aller Beteiligten und das Verständnis, dass es im Kern um die Menschen und eine sehr anspruchsvolle Organisationsveränderung geht und nicht um eine neue IT-Funktionalität. Die Kooperation zwischen den Kommunen, den Verwaltungsbereichen und den Betrieben müsse neu gestaltet werden. Das erfordere von der Verwaltung die Bereitschaft zur Veränderung sowie eine entsprechende finanzielle und personelle Ausstattung. Erfahrungsgemäß werde die Arbeit für die Beschäftigten nicht weniger. Sie verlagere sich auf neue Aufgabenbereiche. Der Wandel gelinge nur, wenn er von den Verantwortlichen hinreichend unterstützt und geführt wird. „Damit man nicht an diesem übergroßen Zielbild scheitert, braucht es eine Roadmap mit kleineren Schritten und konkreten Zwischenergebnissen, eine Kultur des Ausprobierens und des Lernens aus Fehlern – den eigenen ebenso wie denen von anderen –, Strategieanpassungen, wo notwendig, und einen langen Atem“, sind die Smart-City-Experten überzeugt.
http://www.softwareag.de
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe März 2019 von Kommune21 im Schwerpunkt Smart City erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.
Duisburg: Smart City sucht Bürgerideen
[17.04.2025] Ihren Smart-City-Masterplan will die Stadt Duisburgs gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickeln. Noch bis Ende Mai können diese ihre Ideen online einbringen. Die Stadt will alle Vorschläge sichten, bewerten und, sofern möglich, in den neuen Masterplan einbringen. mehr...
Stuttgart: Smart-City-Masterplan in Arbeit
[16.04.2025] Unter Beteiligung der Stadtgesellschaft erarbeitet Stuttgart einen umfassenden Smart-City-Masterplan. In Workshops diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft entsprechende Ideen und Projekte. Online können außerdem Vorhaben bewertet und kommentiert werden. mehr...
Leipzig / Landau in der Pfalz: Modellstädte für KI-gestützte Verkehrssteuerung
[15.04.2025] Die Städte Leipzig und Landau in der Pfalz werden als Pilotregionen im Forschungsprojekt AIAMO (Artificial Intelligence And MObility) an der KI-gestützten Verkehrssteuerung arbeiten. Die Ergebnisse sollen auf kleine und mittlere Kommunen übertragbar sein. mehr...
Regionalkonferenz MPSC: Smart sein
[11.04.2025] Wie Städte digital und nachhaltig wachsen können, steht im Mittelpunkt der 22. Regionalkonferenz des Bundesprogramms Modellprojekte Smart Cities am 3. Juni 2025 in Halle (Saale). mehr...
Interkommunale Zusammenarbeit: Smarte Daten helfen Bauhöfen
[11.04.2025] Daten aus Sensoren und eine App unterstützen die Orte Nauheim, Trebur und Büttelborn dabei, Baumbewässerung und Streueinsätze gezielt zu planen und künftig auch die Beleuchtung bedarfsabhängig zu steuern. Die Kommunen haben das Projekt gemeinsam umgesetzt. mehr...
Digitale Verkehrssteuerung: KIMONO sorgt für Neustart
[10.04.2025] Kaiserslautern hat seiner verkehrstechnischen Infrastruktur bis 2033 eine umfassende Modernisierung und Digitalisierung verordnet. Von den im Rahmen des Projekts KIMONO entstehenden Lösungen können auch andere Kommunen profitieren. mehr...
Hamburg: Parkraum effizient prüfen
[09.04.2025] In Hamburg können Parkberechtigungen digital beantragt und von den Kontrollkräften online überprüft werden. In Zukunft sollen Scan-Fahrzeuge für noch mehr Effizienz bei der Parkraumkontrolle sorgen – vorausgesetzt, die rechtliche Grundlage wird geschaffen. mehr...
Kreis Hameln-Pyrmont: Smart City geht in Verlängerung
[09.04.2025] Der als Modellprojekt Smart Cities geförderte Kreis Hameln-Pyrmont hat die kostenneutrale Verlängerung der Projektlaufzeit um ein Jahr beantragt – mit Erfolg. Durch den zeitintensiven Abstimmungsbedarf wäre der ursprünglich vorgesehene Zeitraum bis Ende 2026 zu kurz für die Kommune gewesen. mehr...
Interkommunales Netzwerk: Mobiler in der Ortenau
[08.04.2025] Das Mobilitätsnetzwerk Ortenau setzt auf nachhaltige Verkehrslösungen und will die analoge sowie digitale Verkehrsinfrastruktur verbessern. Wie die 14 Kommunen vorgehen, erläutert Sarah Berberich, Geschäftsführerin des Beratungsunternehmens endura kommunal. mehr...
Wolfsburg: Mehr als ein Parkleitsystem
[07.04.2025] Die Stadt Wolfsburg plant – ergänzend zu den Informationen, die sie per App übermittelt – ein dynamisches Parkleitsystem in der Innenstadt. Dieses soll eine effiziente Verkehrssteuerung ermöglichen und darüber hinausgehende Informationen liefern, etwa zu Veranstaltungen. mehr...
Fraunhofer FOKUS: Digital Twin hilft beim Routing
[02.04.2025] Das Smart-Mobility-Team von Fraunhofer FOKUS hat im Projekt KIS’M eine Fahrrad-App entwickelt, die auf einem digitalen Zwilling des Berliner Straßenverkehrs basiert. Die App berücksichtigt individuelle Präferenzen bei der Routenplanung und bietet einen Ampelphasenassistenten. mehr...
Local Digital Twins Toolbox: EU-Projekt für Kommunen
[31.03.2025] Mit der Local Digital Twins Toolbox unterstützt die Europäische Kommission Kommunen bei der Einführung entsprechender Lösungen. Teilnehmende Städte und Gemeinden bekommen wichtige Werkzeuge an die Hand und werden individuell beraten. mehr...
Dresden: Website zu Smart-City-Projekten
[31.03.2025] Eine neue Website mit Informationen zu ihren Smart-City-Projekten hat die Stadt Dresden jetzt online gestellt. Zu den momentan 17 geförderten Vorhaben zählen unter anderem die Entwicklung eines interaktiven 3D-Stadtmodells und ein Testfeld für zukunftsfähige Verkehrsstrukturen. mehr...
Landkreis Wunsiedel: Digitaler Zwilling im Aufbau
[31.03.2025] Der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge soll einen Digitalen Zwilling bekommen. Die Ausschreibung für die Anschaffung der nötigen LoRaWAN-Technologie ist bereits gestartet. Erste Anwendungen sollen noch in diesem Jahr in Betrieb gehen, insbesondere im Bereich Katastrophenschutz. mehr...
Troisdorf: Mit der smarT:app die Freizeit gestalten
[28.03.2025] Die smarT:app der Stadt Troisdorf unterstützt Nutzende mit einer interaktiven Karte jetzt auch bei der Freizeitgestaltung. mehr...