Serie OZGHinter den Toren
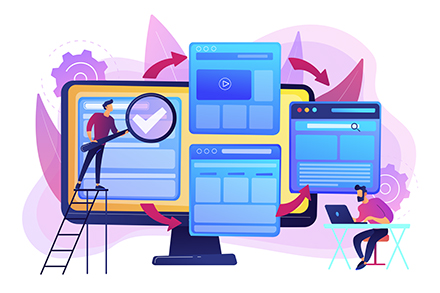
OZG hat nur Front End im Blick.
(Bildquelle: Visual Generation/stock.adobe.com)
Das Onlinezugangsgesetz (OZG) entstand 2017 vor dem Hintergrund, dass bereits vorhandene digitale Verwaltungsleistungen nur ungenügend von Bürgern genutzt wurden. Jahr für Jahr wiesen die einschlägigen Studien und Branchenmonitore bescheidene Anwendungszahlen für Deutschland aus, und man erklärte sich das mangelnde Interesse an den digitalen Services damit, dass diese den Bürgern gar nicht bekannt sind. Mit dem OZG und einer dezidierten Nutzerorientierung bei der Umsetzung soll sich nun alles ändern.
575 Online-Dienste, Serviceportale in allen Bundesländern und die Verknüpfung der Portale zum Verbund – dieses Aufgabenspektrum beschreibt das OZG. Es umfasst das so genannte Front End – Verwaltungsdienste, die von Bürgern online zu Hause genutzt werden können. Womit sich das OZG ausdrücklich nicht befasst, ist das Back End: all jene Fachverfahren, die in Verwaltungen genutzt werden, um Bürgeranliegen IT-gestützt weiterverarbeiten zu können. Das OZG macht sozusagen vor den Toren der Verwaltung halt.
Gesamtprozess im Blick haben
Dabei ist das Ideal der künftigen Verwaltung ein Prozess, der durchgängig digital funktioniert, von der Eingabe am heimischen Computer über das jeweilige Fachverfahren in den Verwaltungen bis hinein in die Register und die elektronischen Akten. Einer der meistgenutzten Online-Dienste ist der Antrag auf Erteilung einer Meldebestätigung. Würde dies per E-Mail geschehen und müsste ein Verwaltungsmitarbeiter die Bürgerdaten händisch in das Software-Programm eintippen, könnte der Bürger, betrachtet man den Prozessaufwand, gleich persönlich zum Amt gehen und sich die Meldebestätigung abholen, wie es ja vielerorts noch üblich ist. „Einen solchen Prozess nicht an ein Einwohnermeldeverfahren zu koppeln, würde nicht nur die Digitalisierung auf den Kopf stellen, sondern dazu führen, dass die Prozesse langwieriger und aufwendiger wären als in der vordigitalen Welt“, sagt Rudolf Schleyer, Vorstandsvorsitzender der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB). Man müsse nicht nur die Schnittstelle zum Bürger betrachten, sondern den Gesamtprozess inklusive der Tätigkeit der Verwaltungsmitarbeiter.
Von innen nach außen entwickelt
Als Anbieter und Entwickler ist die AKDB seit vielen Jahren im Bereich der Fachverfahren tätig und hat schon Online-Dienste entwickelt, lange bevor es das OZG gab. Bereits 2006 hat das Haus eine Auszeichnung für die Barrierefreiheit seiner Kfz-Dienste erhalten. „Schon vor dem OZG hatten wir etwa 65 Online-Dienste im Angebot, die selbstverständlich eine durchgängige Bearbeitung erlauben“, erläutert Gudrun Aschenbrenner, Mitglied des Vorstands der AKDB. Dabei habe die AKDB stets „von innen nach außen“ entwickelt. Will heißen: Ausgehend vom jeweiligen Fachverfahren, das vor allem die gesetzlichen Bestimmungen abbilden muss, sind sowohl die Bedienmasken für die Verwaltungsmitarbeiter als auch der Online-Zugang für Bürger gleich mitentwickelt worden.
Die Erteilung einer Meldebestätigung könnte sogar, wenn es rechtlich zulässig wäre, ein vollautomatischer Prozess sein: Der Bürger gibt die notwendigen Daten für den Antrag ein, das Fachverfahren prüft alle Plausibilitäten, und wenn auch noch eine E-Payment-Funktion integriert ist, kann die Meldebestätigung dem Bürger per E-Mail zugestellt oder in dessen Nutzerkonto hinterlegt werden.
Problematisch wird es dort, wo Anträge über Ländergrenzen hinweg von Verwaltung zu Verwaltung gelangen. Das föderale Deutschland ist geprägt von heterogenen IT-Strukturen. Unter den Bedingungen des geplanten Portalverbunds muss jedoch eine Interoperabilität gewährleistet sein. Ein in Kiel gestellter Antrag auf Ummeldung muss fehlerfrei in München oder Stuttgart ankommen, ohne dass dies von Mitarbeitern geprüft werden müsste. „Heutige Fachverfahren bringen ihre eigenen Online-Dienste mit, die aber nicht unbedingt kompatibel mit Online-Diensten in anderen Portalen sind“, erklärt Rudolf Schleyer. „Der Entwicklungsaufwand ist hier relativ groß, weil es keine Standards für die Datenübergabe aus Online-Diensten hin zu Fachverfahren gibt.“
Rechtliche Rahmenbedingungen müssen angepasst werden
Unter den Herstellern von Fachverfahren rumort es, denn an ihnen bleibt die Arbeit hängen. Stephan Hauber, Geschäftsführer der Firma HSH, kritisiert ebenfalls den Mehraufwand, der entsteht, wenn für die unterschiedlichen Serviceportale in den Bundesländern je eigene Schnittstellen angefertigt werden müssen. HSH ist Marktführer im Bereich Meldewesen und betreut rund 3.000 Meldebehörden bundesweit mit einer Fachanwendung. Auch Hauber betont die Notwendigkeit verlässlicher, qualitativ hochwertiger Standards. Und er hält von den Digitalisierungslaboren recht wenig: „Die Digitalisierungslabore arbeiten zum Teil Dinge auf, die es schon gibt. Gerade für die bürgerintensiven Verfahren, etwa das Meldewesen, gibt es überall schon Lösungen. Hier mangelt es nicht an Ideen, sondern an rechtlichen Rahmenbedingungen.“ Bei einer Ummeldung hapert es beispielsweise daran, dass ein Aufkleber auf dem Personalausweis angebracht und die Daten auf dem Chip geändert werden müssen, was rechtlich bislang nur den Meldebehörden vorbehalten ist. Dabei wären durchaus andere technischen Lösungen denkbar.
Vorhandene Standards nutzen
Die Digitalisierungslabore nehmen zwar notwendige Rechtsänderungen mit in den Blick, doch ob ihre Ergebnisse dann aus einem Guss sind, wird zumindest von den alten Platzhirschen bezweifelt. Ihnen ist auch das Föderale Informationsmanagement (FIM) ein Dorn im Auge. Dieses versucht, neue Standards für Formulare und Prozesse zu etablieren. „Im Meldewesen kennt man seit fast 20 Jahren einen Standard, das ist XMeld“, sagt Hauber. „Nun kommt das OZG und versucht hier FIM überzustülpen. Das halte ich für überflüssig. Man sollte es bei Standards, die gut funktionieren, belassen, und in Segmenten, wo es keine Standards gibt, möglichst schnell welche entwickeln.“
Auch bei der AKDB wird in den XÖV-Produkten, die von der Bremer Koordinierungsstelle für IT-Standards (KoSIT) entwickelt werden, eine gute Ausgangsbasis für bundesweite Einheitlichkeit gesehen. XBau, XMeld, XKfz oder XRechnung sind vorhandene, noch nicht weitverbreitete Standards für digitale Verwaltungsdienste in den Bereichen Bauaufsicht, Meldewesen, Kfz-Zulassung und Rechnungswesen. Diese nun flächendeckend mit verschiedenen Fachverfahren, Online-Diensten und unterschiedlichen Portalanbietern zusammenzubringen, ist das Gebot der Stunde, verlangt aber viel Energie. Rudolf Schleyer: „Es ist im Interesse aller Fachverfahrenshersteller, dass der Aufwand bei der Entwicklung minimiert wird. Deswegen brauchen wir einheitliche Schnittstellendefinitionen, und wir brauchen auch eine größere Power bei den Definitionen. Hier sind der IT-Planungsrat und die FITKO gefordert.“ Und Gudrun Aschenbrenner fügt hinzu: „Wenn man die Mittelverteilung betrachtet, ist festzustellen, dass für Standardisierungsprozesse noch nicht so viel vorgesehen ist. Hier müsste nachgesteuert werden.“
Teil 1 der OZG-Serie
Teil 2 der OZG-Serie
Teil 3 der OZG-Serie
Schleswig-Holstein: Kooperation verlängert
[16.04.2025] Nach fünf erfolgreichen Jahren haben Schleswig-Holstein und der ITV.SH ihre Kooperation zur Verwaltungsdigitalisierung bis Ende 2029 verlängert. Geplant sind unter anderem der Roll-out weiterer digitaler Anträge und Unterstützung für Kommunen bei Informationssicherheits- und IT-Notfällen. mehr...
Darmstadt: Resiliente Krisenkommunikation
[11.04.2025] Großflächige, lang andauernde Stromausfälle sind selten – stellen die Krisenkommunikation jedoch vor Schwierigkeiten, weil Mobilfunk, Internet und Rundfunk ausfallen. In Darmstadt wird nun eine energieautarke digitale Litfaßsäule erprobt, die auch bei Blackouts als Warnmultiplikator funktioniert. mehr...
Diez/Kaisersesch/Montabaur/Weißenthurm: Kooperation im Prozessmanagement
[08.04.2025] Gemeinsam wollen die Verbandsgemeinden Diez, Kaisersesch, Montabaur und Weißenthurm ihre Verwaltungsprozesse effizienter gestalten. Im Fokus steht die Wissensdokumentation ihrer Prozesse. Auch sollen eine Datenbank für Notfallszenarien und ein interkommunales Prozessregister aufgebaut werden. mehr...
Hessen: Projekt Di@-Lotsen wächst weiter
[07.04.2025] Das hessische Digitallotsen-Projekt, das älteren Menschen den Zugang zur digitalen Welt erleichtern soll, wird fortgeführt und ausgeweitet. Kommunen, Vereine und andere Einrichtungen können sich bis zum 11. Mai 2025 als digitale Stützpunkte bewerben. mehr...
Berlin: Beihilfe ohne Medienbrüche
[04.04.2025] In Berlin haben Beamtinnen und Beamte nicht nur die Möglichkeit, Anträge auf Beihilfe digital zu stellen – mit einer neuen App ist es ab jetzt auch möglich, den Bearbeitungsstand einzusehen und die Bescheide digital zu empfangen. mehr...
Interkommunale Zusammenarbeit: Dritte Förderphase für Digitale Dörfer RLP
[01.04.2025] Das Netzwerk Digitale Dörfer RLP erhält bis 2026 weitere 730.000 Euro Landesförderung. Erfolgreiche Digitalprojekte sollen landesweit ausgerollt und die interkommunale Zusammenarbeit gestärkt werden. Ein Schwerpunkt liegt auf wissenschaftlich unterfütterten Pilotprojekten zum Bürokratieabbau. mehr...
Bayern: Ein Jahr Zukunftskommission
[31.03.2025] Die Zukunftskommission #Digitales Bayern 5.0 hat ihren aktuellen Bericht vorgelegt. Unter Leitung des Finanz- und Heimatministeriums erarbeiten Ministerien, Kommunalverbände und Experten Lösungen für eine einheitlichere, effizientere und sicherere IT in Bayerns Kommunen. mehr...
Rheinland-Pfalz: Projekt KuLaDig geht in die nächste Runde
[28.03.2025] Die kulturelle Vielfalt in Rheinland-Pfalz systematisch digital erfassen und für die Öffentlichkeit aufbereiten – das will das Projekt KuLaDig. Nun steht fest, welche Kommunen darin unterstützt werden, ihr kulturelles Erbe digital zu erfassen und zugänglich zu machen. mehr...
Polyteia: Wege für den Datenschutz in der Verwaltung
[27.03.2025] Einer sinnvollen Nutzung kommunaler Daten für die Entscheidungsfindung steht nicht selten der Datenschutz entgegen. Das Projekt ATLAS will zeigen, wie moderne Datenschutztechnologien in der Praxis helfen und echten Mehrwert für den öffentlichen Sektor schaffen. mehr...
Nürnberg: Vier Abholstationen für Ausweisdokumente
[26.03.2025] Die Stadt Nürnberg hat ihr Angebot an Abholstationen für Ausweisdokumente verdoppelt. An insgesamt vier Standorten können die Bürgerinnen und Bürger nun Personalausweise, Reisepässe und eID-Karten unabhängig von den Öffnungszeiten der Bürgerämter abholen. mehr...
Difu-Befragung: Kommunalfinanzen beherrschendes Thema
[25.03.2025] Eine Vorabveröffentlichung aus dem „OB-Barometer 2025“ zeigt, dass kommunale Finanzen das drängendste Thema der Stadtspitzen sind – auch mit Blick auf zukünftige Investitionen. Es sei nötig, dass Kommunen einen beträchtlichen Anteil aus dem Sondervermögen erhielten, so das Difu. mehr...
Berlin: ÖGD wird fit für die Zukunft
[25.03.2025] Mit dem Programm „Digitaler ÖGD“ werden in Berlin Grundlagen für moderne Technologien, Softwarelösungen und schlankere Prozesse in den Einrichtungen des ÖGD geschaffen. Davon können Mitarbeitende wie auch Bürgerinnen und Bürger profitieren. mehr...
Mainz: Ko-Pionier-Sonderpreis 2025
[24.03.2025] Mit dem Ko-Pionier-Sonderpreis 2025 wurde die Stadt Mainz ausgezeichnet. Dieser Preis würdigt Verwaltungen, die innovative Ansätze aus anderen Städten erfolgreich adaptieren und an ihre spezifischen Rahmenbedingungen anpassen. mehr...
LSI Bayern: Ausschuss für Kommunale Fragen zu Gast
[18.03.2025] Bei einer Sitzung des Innenausschusses im LSI standen die Bedrohungslage im Cyberraum und Schutzmaßnahmen für Bayerns IT im Fokus. LSI-Präsident Geisler stellte die Unterstützungsangebote für Kommunen vor, bevor die Abgeordneten das Lagezentrum und das Labor besichtigten. mehr...
Kreis Lüchow-Dannenberg: Ausgezeichnete Digitalisierungsstrategie
[17.03.2025] Für seine herausragende Digitalisierungsstrategie hat der Landkreis Lüchow-Dannenberg das Qualitätssiegel „Top-Organisation 2025“ des Netzwerks Silicon Valley Europe erhalten. mehr...



















