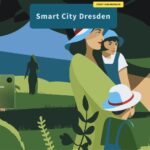GelsenkirchenIntelligent. Vernetzt.

Besuch im stadt.bau.raum Gelsenkirchen.
v.l.: Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart und der damalige Oberbürgermeister von Gelsenkirchen, Frank Baranowski.
(Bildquelle: Stadt Gelsenkirchen/Gerd Kaemper)
E-Government, die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG), die Einrichtung von Serviceportalen, Veränderungen in der Arbeitsweise: Die Digitalisierung bedeutet einen tiefgreifenden Wandel in der gesamten Verwaltung. Gleichzeitig soll der digitale Fortschritt für die Bürger spürbar werden und für mehr Lebensqualität sorgen. Entsprechend treibt Gelsenkirchen seit dem Jahr 2016 die Digitalisierung unter der Marke Gelsenkirchen – die Vernetzte Stadt voran. Heute ist die Ruhrgebietsstadt eine von fünf digitalen Modellregionen in Nordrhein-Westfalen sowie eine von vier deutschen Städten der Intelligent Cities Challenge der Europäischen Kommission und wurde beim diesjährigen Smart City Call des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) zu einer der 32 Modellstädte gekürt.
Integrierte Strategie
In Gelsenkirchen folgen sämtliche Digitalisierungsschritte der Grundphilosophie einer vernetzten Stadt. Denn der Anspruch der Kommune geht über den einer von rein technischen Anwendungen geprägten Vorstellung der Smart City hinaus. Stattdessen soll die Digitalisierung Menschen und Institutionen verbinden: große Unternehmen, den Mittelstand und Start-ups, Vereine und Verbände, soziale Initiativen sowie Kultur- und Bildungseinrichtungen. Sie soll ein wesentlicher Antrieb nicht nur für das Wirtschaftswachstum sein, sondern auch für eine soziale und partizipative Stadtentwicklung. Entsprechend ist die Grundsatzentscheidung Gelsenkirchens zu sehen, sämtliche digitale Aktivitäten – seien es Smart-City-Anwendungen oder E-Government-Maßnahmen – unter diesem gemeinsamen Claim zu denken und zu lenken.
Auf dieser Basis ist im zurückliegenden Jahr auch die Integrierte Strategie Gelsenkirchens entwickelt worden. Mitarbeiter der Stadtverwaltung, kommunale Unternehmen sowie weitere Akteure unter Beteiligung eines externen Beratungsunternehmens haben diese in einem partizipativen Arbeitsprozess erarbeitet. Die für die unterschiedlichen Anspruchsgruppen wichtigsten Themen wurden dazu strukturiert und in fünf Leitthemen zusammengefasst: Digitale und bürgerorientierte Verwaltung, Energie und Umwelt, Lebensqualität und Teilhabe, smarte und nachhaltige Mobilität sowie smarte Wirtschaft. Ein zusätzliches, sechstes Leitthema ist das Open Innovation Lab im ARENA PARK als querschnitts- und zukunftsorientiertes Reallabor der digitalen Stadtentwicklung. Diese Leitthemen bilden die wichtigsten prioritären Entwicklungsstränge für die Zukunft der vernetzten Stadt bis zum Jahr 2030.
Nachhaltig mit Erfolg
Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat die Strategie in seiner Sitzung im Juni 2020 einstimmig beschlossen – ein Beleg dafür, dass das Thema bei allen wichtigen Stakeholdern eine hohe Priorität genießt. Insgesamt bietet die Strategie ein solides Fundament für die erfolgreiche digitale Transformation Gelsenkirchens hin zu einer intelligenten und nachhaltigen Stadt, wie sie die Vereinten Nationen mit dem Nachhaltigkeitsziel 11 im Rahmen der Urbanen Agenda 2030 definiert haben. Die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, kurz: SDGs) nehmen weltweit die ökologisch, wirtschaftlich und sozial nachhaltige Gestaltung von Städten in den Blick. Diese Verpflichtung greift die Gelsenkirchener Strategie zielorientiert auf. Dabei folgt die Stadtentwicklung den UN-HABITAT-III-Beschlüssen und den Empfehlungen, die in der New Urban Agenda im Jahr 2016 festgelegt wurden. Im Kontext der digitalen urbanen Transformation folgt die Gelsenkirchener Strategie zudem den Vorgaben und Empfehlungen der Smart City Charta des Bundes. Auf europäischer Ebene war die Stadt sogar selbst an der Erarbeitung von Zukunftspfaden im Rahmen der Smart Cities Challenge beteiligt. Die Entwicklung der einzelnen inhaltlichen Arbeitsfelder wird in Gelsenkirchen mithilfe von Key Performance Indikatoren (KPIs) nachgehalten und transparent gemacht. Das zeigt: Die Strategie ist keine Momentaufnahme, sondern wird stetig fortgeschrieben.
Modellprojekt Smart Cities
In diesem Jahr hat sich die Stadt Gelsenkirchen mit ihrer integrierten Strategie beim BMI als Modellprojekt Smart Cities beworben. Das Leitmotiv der Bewerbung lautete: „Gemeinsam. Intelligent. Vernetzt.“ Das entsprechende Maßnahmenpaket setzt sich aus sieben Bausteinen zusammen. Die Titel GE beteiligt, GE vernetzt, GE grünt, GE sichert, GE bewegt, GE säubert und GE innoviert geben bereits einen Vorgeschmack auf die Schwerpunkte bei der Umsetzung der Strategie. Anfang September erhielt Gelsenkirchen als eine von 32 erfolgreichen Bewerberinnen den Zuschlag vom BMI. Der Projektantrag sieht ein Gesamtvolumen von 12,7 Millionen Euro vor. Das zeigt eindrucksvoll, dass mittlerweile auch bundesweit wahrgenommen wird, was Gelsenkirchen als digitale Modellstadt seit einigen Jahren auf die Beine stellt.
Infrastruktur bildet Rückgrat
Doch das ist nicht der einzige Erfolgsfaktor für die digitale Vorzeigestadt: Seit über zehn Jahren treibt Gelsenkirchen gemeinsam mit dem kommunalen Unternehmen GELSEN-NET den Aufbau eines leistungsfähigen eigenen Glasfasernetzes als Rückgrat der digitalen Stadtentwicklung voran – alle Gewerbegebiete und die 86 Schulen sind angeschlossen, letztere sogar in Gigabit-Geschwindigkeit. Auf Basis dieser technischen Infrastruktur hat die vernetzte Stadt in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte in den Themenfeldern digitale und bürgerorientierte Verwaltung sowie digitale und nachhaltige Stadtentwicklung umgesetzt. Durch die Einrichtung der Stabsstelle Vernetzte Stadt wurden zudem die entsprechenden Organisations- und Arbeitsstrukturen geschaffen, um sowohl die digitale Stadtentwicklung als auch die digitale Organisationsentwicklung weiter voranzutreiben.
Ziel aller digitaler Anstrengungen in Gelsenkirchen ist es, die Potenziale erstens zu vergrößern und zweitens auch zu nutzen. Denn: Die Vernetzte Stadt – das sind wir alle.
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe November 2020 von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.
Duisburg: Smart City sucht Bürgerideen
[17.04.2025] Ihren Smart-City-Masterplan will die Stadt Duisburgs gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickeln. Noch bis Ende Mai können diese ihre Ideen online einbringen. Die Stadt will alle Vorschläge sichten, bewerten und, sofern möglich, in den neuen Masterplan einbringen. mehr...
Stuttgart: Smart-City-Masterplan in Arbeit
[16.04.2025] Unter Beteiligung der Stadtgesellschaft erarbeitet Stuttgart einen umfassenden Smart-City-Masterplan. In Workshops diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft entsprechende Ideen und Projekte. Online können außerdem Vorhaben bewertet und kommentiert werden. mehr...
Leipzig / Landau in der Pfalz: Modellstädte für KI-gestützte Verkehrssteuerung
[15.04.2025] Die Städte Leipzig und Landau in der Pfalz werden als Pilotregionen im Forschungsprojekt AIAMO (Artificial Intelligence And MObility) an der KI-gestützten Verkehrssteuerung arbeiten. Die Ergebnisse sollen auf kleine und mittlere Kommunen übertragbar sein. mehr...
Regionalkonferenz MPSC: Smart sein
[11.04.2025] Wie Städte digital und nachhaltig wachsen können, steht im Mittelpunkt der 22. Regionalkonferenz des Bundesprogramms Modellprojekte Smart Cities am 3. Juni 2025 in Halle (Saale). mehr...
Interkommunale Zusammenarbeit: Smarte Daten helfen Bauhöfen
[11.04.2025] Daten aus Sensoren und eine App unterstützen die Orte Nauheim, Trebur und Büttelborn dabei, Baumbewässerung und Streueinsätze gezielt zu planen und künftig auch die Beleuchtung bedarfsabhängig zu steuern. Die Kommunen haben das Projekt gemeinsam umgesetzt. mehr...
Digitale Verkehrssteuerung: KIMONO sorgt für Neustart
[10.04.2025] Kaiserslautern hat seiner verkehrstechnischen Infrastruktur bis 2033 eine umfassende Modernisierung und Digitalisierung verordnet. Von den im Rahmen des Projekts KIMONO entstehenden Lösungen können auch andere Kommunen profitieren. mehr...
Hamburg: Parkraum effizient prüfen
[09.04.2025] In Hamburg können Parkberechtigungen digital beantragt und von den Kontrollkräften online überprüft werden. In Zukunft sollen Scan-Fahrzeuge für noch mehr Effizienz bei der Parkraumkontrolle sorgen – vorausgesetzt, die rechtliche Grundlage wird geschaffen. mehr...
Kreis Hameln-Pyrmont: Smart City geht in Verlängerung
[09.04.2025] Der als Modellprojekt Smart Cities geförderte Kreis Hameln-Pyrmont hat die kostenneutrale Verlängerung der Projektlaufzeit um ein Jahr beantragt – mit Erfolg. Durch den zeitintensiven Abstimmungsbedarf wäre der ursprünglich vorgesehene Zeitraum bis Ende 2026 zu kurz für die Kommune gewesen. mehr...
Interkommunales Netzwerk: Mobiler in der Ortenau
[08.04.2025] Das Mobilitätsnetzwerk Ortenau setzt auf nachhaltige Verkehrslösungen und will die analoge sowie digitale Verkehrsinfrastruktur verbessern. Wie die 14 Kommunen vorgehen, erläutert Sarah Berberich, Geschäftsführerin des Beratungsunternehmens endura kommunal. mehr...
Wolfsburg: Mehr als ein Parkleitsystem
[07.04.2025] Die Stadt Wolfsburg plant – ergänzend zu den Informationen, die sie per App übermittelt – ein dynamisches Parkleitsystem in der Innenstadt. Dieses soll eine effiziente Verkehrssteuerung ermöglichen und darüber hinausgehende Informationen liefern, etwa zu Veranstaltungen. mehr...
Fraunhofer FOKUS: Digital Twin hilft beim Routing
[02.04.2025] Das Smart-Mobility-Team von Fraunhofer FOKUS hat im Projekt KIS’M eine Fahrrad-App entwickelt, die auf einem digitalen Zwilling des Berliner Straßenverkehrs basiert. Die App berücksichtigt individuelle Präferenzen bei der Routenplanung und bietet einen Ampelphasenassistenten. mehr...
Local Digital Twins Toolbox: EU-Projekt für Kommunen
[31.03.2025] Mit der Local Digital Twins Toolbox unterstützt die Europäische Kommission Kommunen bei der Einführung entsprechender Lösungen. Teilnehmende Städte und Gemeinden bekommen wichtige Werkzeuge an die Hand und werden individuell beraten. mehr...
Dresden: Website zu Smart-City-Projekten
[31.03.2025] Eine neue Website mit Informationen zu ihren Smart-City-Projekten hat die Stadt Dresden jetzt online gestellt. Zu den momentan 17 geförderten Vorhaben zählen unter anderem die Entwicklung eines interaktiven 3D-Stadtmodells und ein Testfeld für zukunftsfähige Verkehrsstrukturen. mehr...
Landkreis Wunsiedel: Digitaler Zwilling im Aufbau
[31.03.2025] Der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge soll einen Digitalen Zwilling bekommen. Die Ausschreibung für die Anschaffung der nötigen LoRaWAN-Technologie ist bereits gestartet. Erste Anwendungen sollen noch in diesem Jahr in Betrieb gehen, insbesondere im Bereich Katastrophenschutz. mehr...
Troisdorf: Mit der smarT:app die Freizeit gestalten
[28.03.2025] Die smarT:app der Stadt Troisdorf unterstützt Nutzende mit einer interaktiven Karte jetzt auch bei der Freizeitgestaltung. mehr...