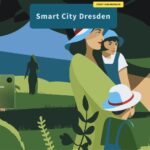Smart CityIntelligenteres Dresden

Smart City: Dresden ist auf dem Weg.
(Bildquelle: Sebastian Weingart)
Was macht eine Stadt smart? Je nach Befragtem gibt es darauf sehr unterschiedliche Antworten. Genau diese Erkenntnis lag dem Vorgehen bei der Erstellung der Smart-City-Strategie Dresden zugrunde. Im Smart City Index des Branchenverbands Bitkom konnte sich Dresden im Jahr 2022 den dritten Platz erkämpfen (wir berichteten). Dieser Indikator zeigte noch vor der Bearbeitung der Strategie, dass in der sächsischen Landeshauptstadt bereits vielfältige Aktivitäten in Richtung Smart City ergriffen wurden. Unterstützen diese Aktivitäten kein gemeinsames Ziel, bleibt es langfristig nur Stückwerk. Das war die Intention bei der Erstellung der Smart-City-Strategie Dresden: zielgerichtete Bündelung bereits existierender Aktivitäten, Ausrichtung aller stadtraumbezogenen Digitalisierungsprojekte auf die strategischen Vorgaben der Smart-City-Strategie, die wiederum auf das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK) ausgerichtet ist sowie Initiierung von Smart-City-Leitprojekten zur Aktivierung der städtischen Organisationseinheiten im Sinne der Smart-City-Strategie.
Dieses Vorgehen passte ideal zum Förderprogramm Modellprojekte Smart Cities des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Der Bund unterstützt seit 2019 inzwischen 73 Kommunen in drei Staffeln. Gefördert werden kommunale, fachübergreifende und raumbezogene Strategien und deren Umsetzung sowie der dafür notwendige Kompetenzaufbau. Im Jahr 2021 stellte Dresden erfolgreich einen entsprechenden Förderantrag (wir berichteten).
Strategie für die smarte Stadt
Die Smart-City-Strategie hat das Wissensarchitektur-Laboratory of Knowledge Architecture, ein interdisziplinärer Thinktank der TU Dresden, in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt erarbeitet. Dabei wurden Leitliniendokumente wie INSEK oder die Smart-City-Charta des Bundes analysiert und Akteure, Projekte und Themen existierender Maßnahmen in einem Smart-City-Radar erfasst. Mit umfangreichen Beteiligungsformaten wurden einerseits Sachverständige aus den Dresdner Fachämtern, andererseits Vertreterinnen und Vertreter aus Zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in den Prozess einbezogen. Aus den Ergebnissen – also den erfassten Potenzialen, Bedarfen und Herausforderungen – wurden Leitlinien und Handlungsfelder formuliert, die den Rahmen für die Entwicklung der Leitprojekte bildeten. Mit einer projektbegleitenden Syntheseforschung wird die Forschungsgruppe Wissensarchitektur die Strategie auf ihre Wirkung prüfen und optimieren. Im Juni 2023 bestätigte der Dresdner Stadtrat das Strategiedokument einschließlich der Umsetzungsmaßnahmen (wir berichteten).
Modellhafte Erprobung bis Ende 2026
Auf Grundlage des INSEK wurden für die Dresdner Strategie drei Modellquartiere identifiziert. In den Pilotquartieren Johannstadt, Friedrichstadt und Dresden-Ost werden bis Ende 2026 mehrere Maßnahmen modellhaft erprobt. Die Erhebung sowie die Weiternutzung von Daten spielen im gesamten Modellprojekt eine entscheidende Rolle. Derzeit entstehen in vielen Kommunen Plattformen zur zentralen und öffentlichen Datenbereitstellung. Dresden verfügt bereits über ein Open-Data-Portal. Ziel des Projekts Open Data ist es, die Potenziale und Vorteile der vorhandenen Plattform für Bürgerschaft, Wirtschaft und Verwaltung klar herauszustellen und zu vereinfachen.
Mit der Cleema-App kann gezielt getestet werden, ob und wie sich Stadtteile durch digitale Tools aktivieren lassen. Nutzerinnen und Nutzer können bei Cleema selbst tätig werden. Die Plattform bietet Informationen und Tipps zum eigenen Verhalten und spielerische Ansätze für nachhaltiges und klimagerechtes Handeln.
Die geplante Sportpark-App ist die zweite App innerhalb des Modellprojekts. Mit dem Sportpark Ostra verfügt Dresden über Sachsens größtes Sportareal. Bis 2030 wird das Gelände zum modernen, nachhaltig gedachten Sportpark ausgebaut. Die App soll Nutzende und Sportflächen digital vernetzen sowie zur Automatisierung von Prozessen beitragen. Da die Angebote für jedermann gedacht sind, ist die Entwicklung der App ein partizipatives Pilotprojekt.
Beteiligung, Umwelt und Klima
Die Maßnahme Smart Participation setzt die Beteiligungsformate der Strategieentwicklung in Zusammenarbeit mit der Wissensarchitektur fort. Hier sollen die Kompetenzen und Angebote der Stadtverwaltung hinsichtlich smarter Bürgerbeteiligung strukturiert und erweitert werden. Ein digitales Beteiligungskonzept soll dies bündeln und das Bürgerlabor als räumliche Schnittstelle unterstützen.
Auch im Bereich Umwelt und Klima gibt es Konzepte für Dresden. Im Zuge der Pilotmaßnahme Umweltmonitoring wird ein digitaler urbaner 3D-Zwilling aufgebaut, mit dem eine differenzierte Warnung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit vor Starkregen und ein Aufzeigen von Handlungsmöglichkeiten für alle relevanten Akteurinnen und Akteure zur Risikominimierung ermöglicht wird.
Das multimodale Verkehrsmanagement-System speist sich ebenfalls aus sensorgestützten Umweltdaten. Innerhalb dieses Projekts werden umweltbezogene Daten analysiert und dafür verwendet, den Straßenverkehr optimiert zu lenken. Einfluss auf die Verkehrsströme können beispielsweise Temperaturen, Regenfälle oder Glatteis haben. Intelligente Lichtsignalanlagen schalten entsprechend um, sodass sensible Bereiche dosiert befahren und weniger belastet werden.
Mobilität und Energieeinsparung
Mobilität ist ein entscheidender Faktor für ein smartes Dresden, deshalb initiiert das Straßen- und Tiefbauamt noch ein zweites Projekt. Das Strategische Erhaltungsmanagement strebt eine nachhaltige Ressourcennutzung an. Baumaßnahmen für Fahrbahnerneuerungen müssen strategisch geplant und realisiert werden, um finanzielle Mittel zielgerichteter und wirtschaftlicher einzusetzen. Innerhalb des Modellprojekts soll ein Echtzeit-Tool entwickelt werden, mit dem der bautechnische Zustand der Straßen ermittelt werden kann.
Die Thematik Energieeinsparung und -optimierung wird konkret in Friedrichstadt und im Dresdner Osten erprobt. Für das Städtische Klinikum Dresden Friedrichstadt soll eine sektorübergreifende Simulation des Energieversorgungssystems aufgebaut werden. Dieses smarte Energiemodell leitet Optimierungsalgorithmen ab, um beispielsweise den Eigenverbrauch der Photovoltaikanlagen zu erhöhen. Darüber hinaus wird ein Energie-Management-System entwickelt, welches das Energieversorgungssystem steuert. Für das energieautarke Wohnquartier wird ein neues Energieversorgungs- und Sanierungskonzept zum Aufbau einer 100 Prozent emissionsfreien Wärme- und Kälteversorgung sowie zur Reduzierung der Betriebskosten realisiert.
Die ausgewählten Modellquartiere stehen in der Projektlaufzeit stellvertretend für alle Stadtteile Dresdens. Die Strategie samt ihren Projekten sollen nach der erfolgreichen Testphase in der gesamten Stadt zum Tragen kommen und Dresden zu einer intelligenteren Stadt machen.
https://tu-dresden.de/bu/architektur/wa/smart_city_dresden
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe November 2023 von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.
Duisburg: Smart City sucht Bürgerideen
[17.04.2025] Ihren Smart-City-Masterplan will die Stadt Duisburgs gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickeln. Noch bis Ende Mai können diese ihre Ideen online einbringen. Die Stadt will alle Vorschläge sichten, bewerten und, sofern möglich, in den neuen Masterplan einbringen. mehr...
Stuttgart: Smart-City-Masterplan in Arbeit
[16.04.2025] Unter Beteiligung der Stadtgesellschaft erarbeitet Stuttgart einen umfassenden Smart-City-Masterplan. In Workshops diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft entsprechende Ideen und Projekte. Online können außerdem Vorhaben bewertet und kommentiert werden. mehr...
Leipzig / Landau in der Pfalz: Modellstädte für KI-gestützte Verkehrssteuerung
[15.04.2025] Die Städte Leipzig und Landau in der Pfalz werden als Pilotregionen im Forschungsprojekt AIAMO (Artificial Intelligence And MObility) an der KI-gestützten Verkehrssteuerung arbeiten. Die Ergebnisse sollen auf kleine und mittlere Kommunen übertragbar sein. mehr...
Regionalkonferenz MPSC: Smart sein
[11.04.2025] Wie Städte digital und nachhaltig wachsen können, steht im Mittelpunkt der 22. Regionalkonferenz des Bundesprogramms Modellprojekte Smart Cities am 3. Juni 2025 in Halle (Saale). mehr...
Interkommunale Zusammenarbeit: Smarte Daten helfen Bauhöfen
[11.04.2025] Daten aus Sensoren und eine App unterstützen die Orte Nauheim, Trebur und Büttelborn dabei, Baumbewässerung und Streueinsätze gezielt zu planen und künftig auch die Beleuchtung bedarfsabhängig zu steuern. Die Kommunen haben das Projekt gemeinsam umgesetzt. mehr...
Digitale Verkehrssteuerung: KIMONO sorgt für Neustart
[10.04.2025] Kaiserslautern hat seiner verkehrstechnischen Infrastruktur bis 2033 eine umfassende Modernisierung und Digitalisierung verordnet. Von den im Rahmen des Projekts KIMONO entstehenden Lösungen können auch andere Kommunen profitieren. mehr...
Hamburg: Parkraum effizient prüfen
[09.04.2025] In Hamburg können Parkberechtigungen digital beantragt und von den Kontrollkräften online überprüft werden. In Zukunft sollen Scan-Fahrzeuge für noch mehr Effizienz bei der Parkraumkontrolle sorgen – vorausgesetzt, die rechtliche Grundlage wird geschaffen. mehr...
Kreis Hameln-Pyrmont: Smart City geht in Verlängerung
[09.04.2025] Der als Modellprojekt Smart Cities geförderte Kreis Hameln-Pyrmont hat die kostenneutrale Verlängerung der Projektlaufzeit um ein Jahr beantragt – mit Erfolg. Durch den zeitintensiven Abstimmungsbedarf wäre der ursprünglich vorgesehene Zeitraum bis Ende 2026 zu kurz für die Kommune gewesen. mehr...
Interkommunales Netzwerk: Mobiler in der Ortenau
[08.04.2025] Das Mobilitätsnetzwerk Ortenau setzt auf nachhaltige Verkehrslösungen und will die analoge sowie digitale Verkehrsinfrastruktur verbessern. Wie die 14 Kommunen vorgehen, erläutert Sarah Berberich, Geschäftsführerin des Beratungsunternehmens endura kommunal. mehr...
Wolfsburg: Mehr als ein Parkleitsystem
[07.04.2025] Die Stadt Wolfsburg plant – ergänzend zu den Informationen, die sie per App übermittelt – ein dynamisches Parkleitsystem in der Innenstadt. Dieses soll eine effiziente Verkehrssteuerung ermöglichen und darüber hinausgehende Informationen liefern, etwa zu Veranstaltungen. mehr...
Fraunhofer FOKUS: Digital Twin hilft beim Routing
[02.04.2025] Das Smart-Mobility-Team von Fraunhofer FOKUS hat im Projekt KIS’M eine Fahrrad-App entwickelt, die auf einem digitalen Zwilling des Berliner Straßenverkehrs basiert. Die App berücksichtigt individuelle Präferenzen bei der Routenplanung und bietet einen Ampelphasenassistenten. mehr...
Local Digital Twins Toolbox: EU-Projekt für Kommunen
[31.03.2025] Mit der Local Digital Twins Toolbox unterstützt die Europäische Kommission Kommunen bei der Einführung entsprechender Lösungen. Teilnehmende Städte und Gemeinden bekommen wichtige Werkzeuge an die Hand und werden individuell beraten. mehr...
Dresden: Website zu Smart-City-Projekten
[31.03.2025] Eine neue Website mit Informationen zu ihren Smart-City-Projekten hat die Stadt Dresden jetzt online gestellt. Zu den momentan 17 geförderten Vorhaben zählen unter anderem die Entwicklung eines interaktiven 3D-Stadtmodells und ein Testfeld für zukunftsfähige Verkehrsstrukturen. mehr...
Landkreis Wunsiedel: Digitaler Zwilling im Aufbau
[31.03.2025] Der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge soll einen Digitalen Zwilling bekommen. Die Ausschreibung für die Anschaffung der nötigen LoRaWAN-Technologie ist bereits gestartet. Erste Anwendungen sollen noch in diesem Jahr in Betrieb gehen, insbesondere im Bereich Katastrophenschutz. mehr...
Troisdorf: Mit der smarT:app die Freizeit gestalten
[28.03.2025] Die smarT:app der Stadt Troisdorf unterstützt Nutzende mit einer interaktiven Karte jetzt auch bei der Freizeitgestaltung. mehr...