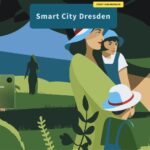InterviewMensch, Prozess und IT

Dr. Fabian Mayer
(Bildquelle: Thomas Niedermüller/Stadt Stuttgart)
Herr Bürgermeister Mayer, laut dem Branchenmagazin Computerwoche gehören Sie zu den fünf besten Chief Information Officers (CIO) im Bereich öffentliche Verwaltung. Womit haben Sie sich diese Auszeichnung verdient?
Mit Digital MoveS, der Digitalisierungsstrategie der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart, und der zugehörigen IT-Strategie. Die Strategie wurde mit übergreifender Kompetenz angegangen und umgesetzt. Insbesondere die Verbindung von Mensch, Prozess und IT wurde dabei gewürdigt.
Welche Philosophie steht dahinter?
Die Digitalisierung ist eine der größten Umwälzungen in der Verwaltung, die es je gegeben hat. Wir achten bei unseren Schritten darauf, dass es verantwortungsvoll, wirtschaftlich und nachhaltig vorangeht. Vor allem muss die Digitalisierung grundlegend an den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet sein. Es ist unsere Überzeugung, dass eine erfolgreiche Digitalisierung nur in dem genannten Dreiklang Mensch, Prozess und IT möglich ist. Kein Thema für sich allein genommen führt zum Erfolg. Dabei ist es uns wichtig, dass die Technik dem Menschen dient und nicht die Menschen der Technik.
Wo liegen die Herausforderungen?
Die digitale Transformation macht vor keinem Bereich unserer Verwaltung Halt. Die Herausforderung liegt nicht nur in der Umsetzung der Vielzahl an Vorhaben – aus der Strategie sind über 100 konkrete Projekte und Maßnahmen entstanden –, sondern auch in deren Steuerung. Digitalisierungsvorhaben zeigen sich komplex und höchst interdependent. Konkret haben wir daher ein Multiprojekt-Management Digital MoveS eingerichtet, das die Programme und Projekte im Blick hat, koordiniert und mir regelmäßig über die Umsetzungsstände berichtet. Zudem haben wir ganz aktuell von knapp 100 geschaffenen Stellen rund 80 mit sehr qualifizierten Expertinnen und Experten besetzt.
„Die Digitalisierung ist eine der größten Umwälzungen in der Verwaltung, die es je gegeben hat.“
Welche konkreten Pläne haben Sie und was wurde bereits umgesetzt?
Von den gut 100 Projekten haben wir die größten auf den Weg gebracht. Beispiele sind das Dokumenten-Management-System, das IT-Service-Management oder die Beschaffung von Hardware, etwa für mobiles Arbeiten. Bereits umgesetzte Projekte sind unter anderem die Bonuscard online oder das neue Rechenzentrum. Zu nennen ist auch die kontinuierliche Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG). Was nach außen oftmals nicht sichtbar wird, sind laufende Umstellungen auf die elektronische Akte. Gut sichtbar ist hingegen unsere neue Homepage.
Die ist im August vergangenen Jahres online gegangen. Was zeichnet die neue Website der Stadt Stuttgart besonders aus?
Die Umsetzung des sehr komplexen Projekts Relaunch www.stuttgart.de ist ein Erfolg, die neue Website ist ansprechend, modern, aufgeräumt und übersichtlich. Das Projekt hat einen immensen Mehrwert für die Landeshauptstadt. In der heutigen Zeit ist die digitale Außenwirkung wichtiger denn je – sie steht für Transparenz, Fortschritt und Innovation. Der Servicegedanke und die besondere Hervorhebung digitaler Leistungen zeigt den Bürgerinnen und Bürgern, dass die Digitalisierung eines der zentralen Themen ist. Außerdem ist die Website barrierefrei und durch Responsive Design vollständig mobil nutzbar. Ganz wichtig ist für uns der Ausbau der Online-Angebote. Aktuell bieten wir fast 60 Online-Dienste an, darunter den barrierefreien Stadtführer für Alle, die Bonuscard + Kultur, den Landesfamilienpass, das An-, Ab- und Ummelden des Wohnsitzes sowie einige Prozesse auf Basis von service-bw.
Welche Rolle spielt die städtische IT bei der Bewältigung der Corona-Krise?
Die Nachfrage nach Online-Services hat deutlich zugenommen. Hier gilt und galt es, schnell Online-Angebote für die Bürgerschaft bereitzustellen. In Zeiten von Corona wurden die technischen Grundlagen und Rahmenbedingungen dafür geschaffen, mobiles Arbeiten in Zukunft für etwa die Hälfte der rund 11.500 Beschäftigten zu ermöglichen. Die städtischen VPN-Zugänge, welche die technische Voraussetzung für mobiles Arbeiten sind, wurden in kürzester Zeit auf 5.800 ausgeweitet. Das hat dazu geführt, dass in der Stuttgarter Stadtverwaltung statt der zuvor etwa 200 Beschäftigten im Frühjahr 2020 deutlich über 2.000 Personen auch im Homeoffice arbeiten konnten. Dies war eine wichtige und erfolgreiche Maßnahme, um einen sehr großen Teil der klassischen Büroarbeitsplätze auch unter den Bedingungen von Corona arbeitsfähig zu machen und so die Leistungsfähigkeit der Verwaltung für die Bürgerschaft aufrechtzuerhalten. Der Ausbau wird kontinuierlich fortgesetzt. Aktuell können rund 5.000 Beschäftigte kurzfristig ins Homeoffice gehen.
Hat Corona die Zweifler an der Digitalisierung der Verwaltung zum Schweigen gebracht?
Die Corona-Krise verleiht der Digitalisierung einen erheblichen Schub. Die Einstellung auch der Zauderer gegenüber der Digitalisierung wendet sich zum Positiven. Um die Digitalisierung der Stadtverwaltung aktiv zu begleiten und auch die Skeptiker zu überzeugen, haben wir in Stuttgart ein Veränderungsmanagement installiert und ein Netzwerk an Multiplikatoren geschaffen, welches stadtweit aktiv ist. Der Veränderungsmanager und das Netzwerk der Digital Mover werden die notwendigen Schritte gehen, um Akzeptanz für die Digitalisierung zu schaffen und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die nötige Motivation für die Umsetzung der Strategie Digital MoveS zu wecken. Wir nehmen jeden Einzelnen mit.
Wie hat sich durch die Pandemie das Mindset der Führungskräfte geändert?
Führungskräfte waren zum Teil positiv überrascht, dass die Aufgabenerledigung im Homeoffice so gut funktioniert hat. Sie stellten aber teilweise einen höheren Koordinationsaufwand durch das mobile Arbeiten ihrer Mitarbeiter fest. Bei technikaffinen Personen hat sich die Möglichkeit, mit mobilen Endgeräten, Chat und Telefonkonferenzen effizient zu arbeiten, sehr schnell etabliert. Ein Teil der Führungskräfte muss sich auf diese neue Art der Führung und Kommunikation mit ihren Teams noch einstellen. Daher werden wir unsere internen Schulungsmaßnahmen zu diesen Themen gezielt ausbauen. Aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem Homeoffice während der Pandemie bin ich sicher, dass das mobile Arbeiten bei dafür geeigneten Aufgabenstellungen auch in der öffentlichen Verwaltung künftig ein fester Bestandteil des Arbeitsalltags sein wird.
Wie lange wird es noch dauern, bis die Stadtverwaltung Stuttgart durchgängig digitalisiert ist?
Die Digitalisierung ist eine Transformation der Stadtverwaltung und ein großer Prozess, der nie vollständig beendet sein kann – spürbare Verbesserungen für den Bürger werden im Rahmen des OZG realisiert werden. Hier kann Stuttgart nicht alleine handeln. Die Stadtverwaltung ist hierbei auch abhängig von Gesetzesänderungen. Digitalisierung bedeutet aber auch, an vielen Stellen Prozesse zu optimieren. Das braucht natürlich Zeit.
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe März 2021 von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.
Duisburg: Smart City sucht Bürgerideen
[17.04.2025] Ihren Smart-City-Masterplan will die Stadt Duisburgs gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickeln. Noch bis Ende Mai können diese ihre Ideen online einbringen. Die Stadt will alle Vorschläge sichten, bewerten und, sofern möglich, in den neuen Masterplan einbringen. mehr...
Stuttgart: Smart-City-Masterplan in Arbeit
[16.04.2025] Unter Beteiligung der Stadtgesellschaft erarbeitet Stuttgart einen umfassenden Smart-City-Masterplan. In Workshops diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft entsprechende Ideen und Projekte. Online können außerdem Vorhaben bewertet und kommentiert werden. mehr...
Leipzig / Landau in der Pfalz: Modellstädte für KI-gestützte Verkehrssteuerung
[15.04.2025] Die Städte Leipzig und Landau in der Pfalz werden als Pilotregionen im Forschungsprojekt AIAMO (Artificial Intelligence And MObility) an der KI-gestützten Verkehrssteuerung arbeiten. Die Ergebnisse sollen auf kleine und mittlere Kommunen übertragbar sein. mehr...
Regionalkonferenz MPSC: Smart sein
[11.04.2025] Wie Städte digital und nachhaltig wachsen können, steht im Mittelpunkt der 22. Regionalkonferenz des Bundesprogramms Modellprojekte Smart Cities am 3. Juni 2025 in Halle (Saale). mehr...
Interkommunale Zusammenarbeit: Smarte Daten helfen Bauhöfen
[11.04.2025] Daten aus Sensoren und eine App unterstützen die Orte Nauheim, Trebur und Büttelborn dabei, Baumbewässerung und Streueinsätze gezielt zu planen und künftig auch die Beleuchtung bedarfsabhängig zu steuern. Die Kommunen haben das Projekt gemeinsam umgesetzt. mehr...
Digitale Verkehrssteuerung: KIMONO sorgt für Neustart
[10.04.2025] Kaiserslautern hat seiner verkehrstechnischen Infrastruktur bis 2033 eine umfassende Modernisierung und Digitalisierung verordnet. Von den im Rahmen des Projekts KIMONO entstehenden Lösungen können auch andere Kommunen profitieren. mehr...
Hamburg: Parkraum effizient prüfen
[09.04.2025] In Hamburg können Parkberechtigungen digital beantragt und von den Kontrollkräften online überprüft werden. In Zukunft sollen Scan-Fahrzeuge für noch mehr Effizienz bei der Parkraumkontrolle sorgen – vorausgesetzt, die rechtliche Grundlage wird geschaffen. mehr...
Kreis Hameln-Pyrmont: Smart City geht in Verlängerung
[09.04.2025] Der als Modellprojekt Smart Cities geförderte Kreis Hameln-Pyrmont hat die kostenneutrale Verlängerung der Projektlaufzeit um ein Jahr beantragt – mit Erfolg. Durch den zeitintensiven Abstimmungsbedarf wäre der ursprünglich vorgesehene Zeitraum bis Ende 2026 zu kurz für die Kommune gewesen. mehr...
Interkommunales Netzwerk: Mobiler in der Ortenau
[08.04.2025] Das Mobilitätsnetzwerk Ortenau setzt auf nachhaltige Verkehrslösungen und will die analoge sowie digitale Verkehrsinfrastruktur verbessern. Wie die 14 Kommunen vorgehen, erläutert Sarah Berberich, Geschäftsführerin des Beratungsunternehmens endura kommunal. mehr...
Wolfsburg: Mehr als ein Parkleitsystem
[07.04.2025] Die Stadt Wolfsburg plant – ergänzend zu den Informationen, die sie per App übermittelt – ein dynamisches Parkleitsystem in der Innenstadt. Dieses soll eine effiziente Verkehrssteuerung ermöglichen und darüber hinausgehende Informationen liefern, etwa zu Veranstaltungen. mehr...
Fraunhofer FOKUS: Digital Twin hilft beim Routing
[02.04.2025] Das Smart-Mobility-Team von Fraunhofer FOKUS hat im Projekt KIS’M eine Fahrrad-App entwickelt, die auf einem digitalen Zwilling des Berliner Straßenverkehrs basiert. Die App berücksichtigt individuelle Präferenzen bei der Routenplanung und bietet einen Ampelphasenassistenten. mehr...
Local Digital Twins Toolbox: EU-Projekt für Kommunen
[31.03.2025] Mit der Local Digital Twins Toolbox unterstützt die Europäische Kommission Kommunen bei der Einführung entsprechender Lösungen. Teilnehmende Städte und Gemeinden bekommen wichtige Werkzeuge an die Hand und werden individuell beraten. mehr...
Dresden: Website zu Smart-City-Projekten
[31.03.2025] Eine neue Website mit Informationen zu ihren Smart-City-Projekten hat die Stadt Dresden jetzt online gestellt. Zu den momentan 17 geförderten Vorhaben zählen unter anderem die Entwicklung eines interaktiven 3D-Stadtmodells und ein Testfeld für zukunftsfähige Verkehrsstrukturen. mehr...
Landkreis Wunsiedel: Digitaler Zwilling im Aufbau
[31.03.2025] Der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge soll einen Digitalen Zwilling bekommen. Die Ausschreibung für die Anschaffung der nötigen LoRaWAN-Technologie ist bereits gestartet. Erste Anwendungen sollen noch in diesem Jahr in Betrieb gehen, insbesondere im Bereich Katastrophenschutz. mehr...
Troisdorf: Mit der smarT:app die Freizeit gestalten
[28.03.2025] Die smarT:app der Stadt Troisdorf unterstützt Nutzende mit einer interaktiven Karte jetzt auch bei der Freizeitgestaltung. mehr...