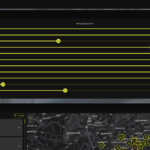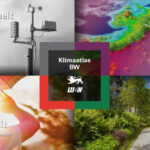Edge ComputingNäher am Geschehen

Detlef Spang, CEO bei Colt Data Centre Services
(Bildquelle: Colt DCS)
Herr Spang, zahlreiche Kommunen machen sich derzeit auf den Weg, Smart City zu werden. Welche Hindernisse müssen sie überwinden?
Intelligente Technologien lösen einige Probleme, die Stadtbewohner derzeit plagen – von der schlechten Luftqualität über chronisch verstopfte Straßen bis hin zu Aspekten der öffentlichen Sicherheit. Das Internet of Things (IoT) wird die Art und Weise verändern, wie Kommunen die Energieversorgung, Verkehrssysteme oder ihre Abfallentsorgung organisieren. Der Erfolg neuer smarter Dienste hängt allerdings auch von der Fähigkeit ab, unvorstellbare Datenmengen zu generieren, zu verarbeiten und zu analysieren. Sensoren zur Messung der Luftqualität, Kameras zur Überwachung von Transportsystemen, intelligente Ampeln oder smarte Mülltonnen: Eine Smart City wird aus einem Netzwerk von Computern bestehen und ständig große Mengen an Informationen erzeugen, die in Echtzeit zu verarbeiten sind. Politik, Unternehmen und Bürger sind sich über das Potenzial intelligenter Städte einig. Die traditionellen Technologie-Infrastrukturen blockieren den Fortschritt jedoch. Sie sind ein großes Hindernis, denn sie sind nicht auf die datenintensiven Prozesse intelligenter Städte ausgelegt.
Was kann Kommunen helfen, diese Hürden zu überwinden?
Smart-City-Technologien sind auf Echtzeitergebnisse angewiesen. Wenn die Speicherung an einem zentralen Knotenpunkt stattfindet, der sich möglicherweise gar nicht in der eigenen Stadt befindet, kommt es zu Verzögerungen. Diese bewegen sich zwar nur im Millisekundenbereich, können aber verheerende Folgen haben. Das gilt etwa für Machine-to-Machine-Anwendungen in einem integrierten Verkehrssystem, das gleichzeitig die Bewegungen von Bussen und Straßenbahnen, Fußgängern oder Autos steuert. Konnektivität und Datentransfer müssen deshalb jederzeit schnell, stabil und konsistent sein, um einen reibungsfreien Ablauf aufrechtzuerhalten und Unfälle oder Störungen zu reduzieren oder zu verhindern. Hier kommt Edge Computing ins Spiel.
„Smart-City-Technologien sind auf Echtzeitergebnisse angewiesen, Verzögerungen können verheerende Folgen haben.“
Welche Vorteile bietet Edge Computing?
Beim Edge Computing handelt es sich um einen verteilten IT-Ansatz, mit dem Rechenleistung näher ans Geschehen – also an Sensoren, Geräte und Maschinen – gebracht wird. Bestehende Dienste lassen sich so schneller abwickeln, da die Daten nah am Ort der Entstehung und damit ohne hohe Antwortzeiten verarbeitet werden. Sofern überhaupt nötig, werden die Ergebnisse erst in einem zweiten Schritt an ein zentralisiertes Rechenzentrum übermittelt. Bei vielen der heute und in Zukunft generierten Daten handelt es sich jedoch um Informationen, die zwar sehr schnell erzeugt, oft aber nur einmalig zur Entscheidungsfindung benötigt werden, und danach keine Rolle mehr spielen. Beim Edge Computing lassen sich diese Daten dezentral und direkt an den Enden des Netzwerks erfassen und verarbeiten.
Wie kann man sich Edge Computing in der Smart City vorstellen?
Technologien wie Drohnen, selbstfahrende Autos und integrierte Verkehrsüberwachungssysteme sind Beispiele für antwortzeitsensitive Dienste, die am Rand – also am Edge angesiedelt sein sollten. Während diese Geräte oder Dienste zahlreiche zeitkritische Daten produzieren, stehen ihnen etliche Prozesse gegenüber, mit weitaus weniger hohen Anforderungen an die Konnektivität. Diese Daten sind nicht weniger bedeutsam, doch folgt durch eine geringe Netzwerkverzögerung keine kritische Reaktion. Deshalb sind hybride Rechenzentrumsmodelle sinnvoll. Zeitunkritischere Inhalte lassen sich somit weiterhin in Server-Farmen hosten, da diese datenintensive Anforderungen erfüllen und problemlos skalierbar sind.
Welches Vorgehen empfehlen Sie bei der Etablierung des Edge Computing in der Smart City?
Hybride Rechenzentrumsmodelle stellen Verantwortliche auch vor eine große organisatorische Aufgabe. Sie müssen sicherstellen, dass Dienste sowohl am Rand des Netzwerks als auch in der Hyper-Scale-Anlage bereitstehen. Hosting- oder Netzwerkunternehmen arbeiten hart daran, Lösungen für diese Herausforderungen zu entwickeln. Dafür ist eine enge Zusammenarbeit mit Regierungen und Kommunen notwendig, um herauszufinden, wie eine Vielzahl neuer smarter Dienste mithilfe eines zukunftsweisenden Infrastrukturmodells bereitgestellt werden kann.
Wuppertal: Datenplattform gestartet
[05.02.2025] Die neue Plattform DigiTal Daten der Stadt Wuppertal liefert Echtzeitinformationen aus der Stadt und ist Teil des Modellprojekts Smart City. Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, Feedback zu dem ersten Prototyp zu geben. mehr...
Wiesbaden: Experimentierraum für Digitalprojekte
[04.02.2025] Mit dem Zukunftswerk hat die Stadt Wiesbaden jetzt einen innovativen Experimentierraum eröffnet, der unter dem Motto Stadtlabor2Go die Prinzipien von Bürgerbeteiligung, Nachhaltigkeit und Smart City vereint. mehr...
Saarbrücken: Dashboard für die Smart City
[04.02.2025] Die Stadt Saarbrücken hat ihr Smart City Dashboard veröffentlicht. Das Digitalisierungsdezernat hat dabei auf Open-Source-Technologie gesetzt und den Open-Data-Ansatz verfolgt. Entwickelt wurde das Dashboard von einem Start-up. mehr...
Kreis Recklinghausen: Info-Plattform zum Smart-City-Ansatz
[03.02.2025] Eine Informationsplattform zur regionalen Digitalisierungsstrategie haben der Kreis Recklinghausen und die zehn kreisangehörigen Städte online geschaltet. Das Portal stellt die fünf Handlungsfelder und unterschiedlichen Projekte rund um den Smart-City-Ansatz vor und listet Neuigkeiten und Veranstaltungshinweise auf. mehr...
Kreis Bergstraße: Straßenzustand KI-gestützt erfassen
[30.01.2025] Der Kreis Bergstraße erfasst im Zuge eines Smart-Region-Vorhabens den Straßenzustand besonders effizient: Müllfahrzeuge filmen per Smartphone die Straßen, eine KI wertet die erfassten Daten aus. Diese werden dann den kreisangehörigen Kommunen zur Verfügung gestellt. mehr...
Stuttgart: Smart-City-Projekte im Blick
[30.01.2025] Die Stadt Stuttgart präsentiert die Fortschritte ihrer Digitalisierungsprojekte fortan gebündelt in einem Digitalmonitor. Das an die Öffentlichkeit gerichtete Onlineportal soll zeigen, was bereits erreicht wurde und wie die Stadt mittels digitaler Lösungen zukunftsfähig wird. mehr...
Baden-Württemberg: Klimaatlas ist online
[27.01.2025] Um gezielt auf den Klimawandel zu reagieren, liefert der Klimaatlas Baden-Württemberg Kommunen eine umfassende Datengrundlage. Mit lokalisierten Klimaprofilen und Planungshinweisen, etwa zu Hitzebelastungen, unterstützt er Vorsorge und Anpassungsmaßnahmen vor Ort. mehr...
Hessen: Digitale Zukunft im ländlichen Raum
[22.01.2025] Die Digitalisierung bietet auch Kommunen im ländlichen Raum Chancen, um Lebensqualität, Nachhaltigkeit und Effizienz zu verbessern. Dies zeigen verschiedene Projekte aus Hessen, bei denen vernetzte Sensoren und Datendashboards zum Einsatz kommen. mehr...
Modellprojekte Smart Cities: 19. Regionalkonferenz in Osnabrück
[20.01.2025] Osnabrück lädt am 5. Februar zur 19. Regionalkonferenz der Modellprojekte Smart Cities ein. Zentrales Thema ist die energieeffiziente Kommune. Es soll gezeigt werden, wie mit den Werkzeugen der Smart City Energie gespart, Mobilität intelligent geplant oder die Ressourcenverteilung geschickt ausgestaltet werden kann. mehr...
Bonn/Bremen: Baupotenzial smart ermitteln
[16.01.2025] Um bislang ungenutzte Flächen für Wohnbebauung zu finden, arbeiten die Städte Bonn und Bremen jeweils an einem innovativen Baupotenzialkataster, bei dem bestehende Daten KI-gestützt und automatisiert zusammengeführt werden. Die Vorhaben werden vom Bund finanziell gefördert. mehr...
Flensburg: Smarte Füllstandsmelder für den Müll
[15.01.2025] Die Stadt Flensburg digitalisiert ihre Abfallentsorgung. Sensoren in Abfallbehältern übermitteln Daten zum Füllstand, sodass Fahrten und Logistik reduziert werden können. Ein erster Test zeigt vielversprechende Ergebnisse. mehr...
Kalletal/Lemgo: Digital Award für Hochwasserinfosystem
[10.01.2025] Das Hochwasserinfosystem der Kommunen Kalletal und Lemgo ist auf der Messe KommDIGITALE mit einem Digital-Award geehrt worden. Die Lösung soll noch in diesem Jahr per Open CoDE für Nachnutzer zugänglich gemacht werden. mehr...
Modellprojekte Smart Cities: Laufzeitverlängerung bis 2028
[16.12.2024] Da der ursprünglich angesetzte Förderzeitraum zu knapp bemessen war, wurde den Kommunen der dritten Staffel der Modellprojekte Smart Cities eine kostenneutrale Verlängerung bis Ende März 2028 angeboten. Hildesheim will davon Gebrauch machen. Der Zeitplan aber ist eng. mehr...
Aalen: InKoMo 4.0 abgeschlossen
[16.12.2024] Das Aalener Projekt InKoMo 4.0, welches mittels Sensorik verfügbare Parkplätze erkennt und diese Informationen in Echtzeit an dynamische LED-Tafeln sowie das städtische Geodatenportal übermittelt, fand jetzt seinen Abschluss. Das Konzept lässt sich auf andere Kommunen übertragen. mehr...
Osnabrück: Schule digitalisiert Energieverbrauch
[13.12.2024] Das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium in Osnabrück hat jetzt im Rahmen eines Smart-City-Pilotprojekts seinen Energieverbrauch digitalisiert. mehr...