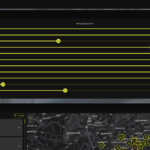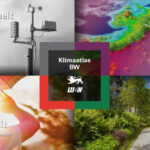PwC-StudieParkraum-Management und Mobilität
Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) hat im Rahmen eines vom Umweltbundesamt beauftragten Forschungsvorhabens eine Broschüre zum Parkraum-Management erarbeitet und jetzt publiziert. Demnach bietet digitales Management innerstädtischer Parkflächen Kommunen großes Potenzial, um den Stadtverkehr effizienter und nachhaltiger zu organisieren. Eine Reduzierung von Parkraum in Innenstädten und Wohngebieten, eine Erhöhung der Parkgebühren, mehr Parkplätze für Carsharing- und Elektrofahrzeuge sowie Park-und-Ride-Angebote mit Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr können zudem den Umstieg auf nachhaltige Mobilitätsangebote unterstützen. Damit ließen sich Emissionen und Flächenverbrauch in den Städten reduzieren. Zu diesen Schlüssen kommt PwC in der Veröffentlichung „Parkraummanagement für eine nachhaltige urbane Mobilität in der Stadt für Morgen“.
Heute sei es noch so, dass in deutschen Innenstädten Parkplätze Flächen blockierten, die anderweitig genutzt die Lebensqualität der Stadtbevölkerung verbessern könnten, so PwC. Weitere negative Effekte der Innenstadtparker: Der Anteil des Parksuchverkehrs in innenstadtnahen Stadtgebieten liegt bei 20 bis 50 Prozent des Gesamtverkehrs. Dies habe eine Untersuchung der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin gezeigt. Somit sei die Folge von Dauerparken nicht nur ein hoher Anteil von parkenden Fahrzeugen, sondern auch zusätzlicher Verkehr in den Innenstädten. Zudem begünstige die aktuelle Parkplatzsituation in vielen Innenstädten den motorisierten Individualverkehr mit allen damit verbundenen negativen Effekten wie Schadstoff- und Lärmemissionen oder dem Verzehr attraktiver innerstädtischer Flächen – sei es beim Pendeln zur Arbeit oder für innerstädtische Besorgungen.
Nachhaltiger Verkehr ist keine Utopie
Nachhaltiger Verkehr und modernes Parkraum-Management seien jedoch keine Utopien. In einigen Städten werden bereits sinnvolle Lösungen umgesetzt, die den Stadtverkehr reduzieren und gleichzeitig den Umweltverbund aus ÖPNV und aktiver Mobilität stärken, so der PwC-Verkehrsexperte Maximilian Rohs. Beispiel seien San Francisco oder Amsterdam. In beiden Städten werden intelligente digitale Park-Lösungen eingesetzt. In Amsterdam könnten beispielsweise Smart Parking-Apps in der Regel auch den Weg zum nächsten freien Platz anzeigen und dadurch den Verkehr bei der Parkplatzsuche verringern. Um die Entstehung zusätzlichen Verkehrs durch die vereinfachte Parkplatzsuche zu vermeiden, seien aber gleichzeitig Einschränkungen des motorisierten Individualverkehrs sowie der Ausbau attraktiver Mobilitätsalternativen erforderlich.
Neben digitalen Lösungen schlagen die Autoren von PwC außerdem Möglichkeiten vor, den Umstieg auf smarte Mobilitätsangebote zu fördern. Dazu zählen etwa Jobtickets oder eine monatliche Prämie für Mitarbeitende, die auf einen Firmenparkplatz verzichten. Ein ähnlich konzipiertes „Parking Cash Out“-Projekt in Kalifornien zeige, dass solche Anreize berufsbedingten Individualverkehr reduzieren. Auch über die Bauordnung könne das Verkehrsgeschehen beeinflusst werden. So könnten die Bundesländer beziehungsweise Städte und Kommunen die Kfz-Stellplatzpflicht bei (Wohn-)Bauvorhaben reduzieren oder ganz abschaffen, wie Hamburg und Berlin es bereits vormachen. Um nachhaltigeren Verkehr zu fördern, sei es zudem sinnvoll, bestehende Parkkontingente im privaten und öffentlichen Raum für Carsharing- und E-Fahrzeuge auszuweisen.
https://www.umweltbundesamt.de
https://www.pwc.de
Eppishausen: Pegel werden automatisch gemessen
[24.02.2025] Eppishausen spart dank automatischer Messung Zeit und Aufwand bei der Pegelmessung. Die erhobenen Daten werden in Echtzeit per LoRaWAN an die Verantwortlichen in der Gemeinde übertragen. Ab einem definierten Grenzwert erhalten sie eine Benachrichtigung per SMS oder E-Mail. mehr...
Schwandorf: Digitaler Zwilling spart Ressourcen
[24.02.2025] Ein Digitaler Zwilling hilft der Stadt Schwandorf bei der passgenauen Grünbewässerung. Während Bodenfeuchtigkeitssensoren Echtzeitdaten zum aktuellen Bewässerungsbedarf liefern, zeigt der Digitale Zwilling an, wo genau bewässert werden muss. Eine Ausweitung auf andere Bereiche ist angedacht. mehr...
Mönchengladbach: Regionalkonferenz Smart Cities 2025
[19.02.2025] Mönchengladbach wird am 12. März Austragungsort der Regionalkonferenz Smart Cities des BMWSB. Workshops und kurze Praxisberichte widmen sich Themen wie KI und Bürgerbeteiligung. Tags darauf findet am gleichen Ort der SmartCity.Summit Niederrhein statt. mehr...
Wolfsburg: Bundestagswahl in der Stadt-App
[18.02.2025] Die Stadt Wolfsburg will über die Integration des beliebten Wahl-O-Mat in ihre Stadt-App die Aufmerksamkeit von Bürgerinnen und Bürgern auf die bevorstehende Bundestagswahl lenken und gleichzeitig dazu beitragen, dass die Wahlentscheidung erleichtert wird. mehr...
Freiburg: Mehr Sicherheit bei Großveranstaltungen
[17.02.2025] Mehr Sicherheit bei Großveranstaltungen durch digitale Technik – so lautet der Ansatz des Projekts FreiburgRESIST. Dafür sollen in der Freiburger Innenstadt nun bis zu 200 Sensoren angebracht werden, die auf Basis von anonymisierten Handydaten messen können, wo sich wie viele Menschen aufhalten und in welche Richtung sie strömen. mehr...
Gelsenkirchen: Besucherströme steuern
[14.02.2025] Im Rahmen des Projekts GE sichert entwickelt die Stadt Gelsenkirchen ein innovatives Konzept zur anonymisierten Bewegungsdatenerfassung und -prognose. Die videobasierte Sensorik kam unter anderem während der EM-Spiele 2024 zum Einsatz. mehr...
Smart City Steckbriefe: Eine Quelle der Inspiration
[10.02.2025] Wie strukturierte Steckbriefe Kommunen als Inspiration für eigene Smart-City-Projekte dienen können, erläutert Chantal Schöpp von der Agentur Creative Climate Cities, die als Partnerin der KTS für das Projekt verantwortlich zeichnet. mehr...
Forschung: Mit Daten Barrieren im ÖPV überwinden
[10.02.2025] Das Forschungsprojekt OPENER next kombiniert moderne Datenanalyse und bürgerschaftliches Engagement. Ziel ist es, die Barrierefreiheit im öffentlichen Personenverkehr (ÖPV) digital zu verbessern. mehr...
Wuppertal: Datenplattform gestartet
[05.02.2025] Die neue Plattform DigiTal Daten der Stadt Wuppertal liefert Echtzeitinformationen aus der Stadt und ist Teil des Modellprojekts Smart City. Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, Feedback zu dem ersten Prototyp zu geben. mehr...
Wiesbaden: Experimentierraum für Digitalprojekte
[04.02.2025] Mit dem Zukunftswerk hat die Stadt Wiesbaden jetzt einen innovativen Experimentierraum eröffnet, der unter dem Motto Stadtlabor2Go die Prinzipien von Bürgerbeteiligung, Nachhaltigkeit und Smart City vereint. mehr...
Saarbrücken: Dashboard für die Smart City
[04.02.2025] Die Stadt Saarbrücken hat ihr Smart City Dashboard veröffentlicht. Das Digitalisierungsdezernat hat dabei auf Open-Source-Technologie gesetzt und den Open-Data-Ansatz verfolgt. Entwickelt wurde das Dashboard von einem Start-up. mehr...
Kreis Recklinghausen: Info-Plattform zum Smart-City-Ansatz
[03.02.2025] Eine Informationsplattform zur regionalen Digitalisierungsstrategie haben der Kreis Recklinghausen und die zehn kreisangehörigen Städte online geschaltet. Das Portal stellt die fünf Handlungsfelder und unterschiedlichen Projekte rund um den Smart-City-Ansatz vor und listet Neuigkeiten und Veranstaltungshinweise auf. mehr...
Kreis Bergstraße: Straßenzustand KI-gestützt erfassen
[30.01.2025] Der Kreis Bergstraße erfasst im Zuge eines Smart-Region-Vorhabens den Straßenzustand besonders effizient: Müllfahrzeuge filmen per Smartphone die Straßen, eine KI wertet die erfassten Daten aus. Diese werden dann den kreisangehörigen Kommunen zur Verfügung gestellt. mehr...
Stuttgart: Smart-City-Projekte im Blick
[30.01.2025] Die Stadt Stuttgart präsentiert die Fortschritte ihrer Digitalisierungsprojekte fortan gebündelt in einem Digitalmonitor. Das an die Öffentlichkeit gerichtete Onlineportal soll zeigen, was bereits erreicht wurde und wie die Stadt mittels digitaler Lösungen zukunftsfähig wird. mehr...
Baden-Württemberg: Klimaatlas ist online
[27.01.2025] Um gezielt auf den Klimawandel zu reagieren, liefert der Klimaatlas Baden-Württemberg Kommunen eine umfassende Datengrundlage. Mit lokalisierten Klimaprofilen und Planungshinweisen, etwa zu Hitzebelastungen, unterstützt er Vorsorge und Anpassungsmaßnahmen vor Ort. mehr...