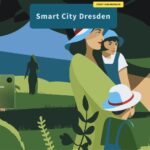InterviewPulsgeber für Daten

Nikolaus Hagl ist seit 2019 Leiter des Geschäftsbereichs Public & Energy und Mitglied der Geschäftsleitung bei SAP Deutschland.
(Bildquelle: SAP Deutschland SE)
Herr Hagl, die Stadt der Zukunft ist auf Daten gebaut. Darauf weist der Deutsche Städtetag in einer Studie hin. Welche Chancen birgt das für ein Technologieunternehmen wie SAP?
Es ist richtig und wichtig, dass sich die Städte jetzt damit auseinandersetzen, mit kommunalen Daten die Zukunft zu gestalten. Das ist in der Tat eine Chance, um auf dem Digitalisierungspfad voranzukommen. Nun geht es darum, die Daten richtig zu nutzen und für die richtigen Zwecke einzusetzen. Um das zu ermöglichen, bietet SAP die Business Technology Platform an, die auch den Kommunen zur Verfügung steht.
Digitalisierung ist für Kommunen eigentlich nichts Neues. Allerdings rückt das Thema erst jetzt ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit. In welchen Bereichen unterstützt SAP die Kommunen und ihre Betriebe bei der digitalen Transformation?
Es ist in der Tat interessant, dass jetzt erst von digitaler Transformation gesprochen wird. Denn digitale Lösungen für Kommunalverwaltungen gibt es schon lange. Der Unterschied ist, dass heute die Vernetzung und die Nutzung von Daten im Fokus stehen. Zudem erwarten die Bürgerinnen und Bürger von ihrer Stadt oder Gemeinde, dass Online-Services angeboten werden. Die Basis dafür ist ein stabiler digitaler Kern, der die Verwaltungsprozesse abbildet. Beim Aufbau dieses Fundaments unterstützt SAP die Kommunen und ihre Betriebe. Dann können End-to-End-Prozesse entwickelt und angeboten werden – und das auch ebenenübergreifend. Es entsteht eine Art Kreislauf mit digitalen Prozessen und einem Mehrwert für die Bürgerschaft, der Input der Bürger wiederum erhöht die Effizienz in der Kommune. Diesen Kreislauf gab es früher nicht.
Die Stadt der Zukunft ist vernetzt. Das Stichwort lautet: Smart City. Wo stehen die deutschen Städte, Gemeinden und Landkreise im internationalen Vergleich?
Ich bin kein Freund dieser Vergleiche, die meist hinken. Die ersten Smart-City-Projekte wurden in Megacities durchgeführt, etwa in Buenos Aires oder Kapstadt. Die kommunale Struktur in Deutschland ist sozusagen mittelständisch geprägt, da helfen Smart-City-Rankings nicht weiter. Nach meiner Einschätzung führen die Smart-City-Initiativen hierzulande in die richtige Richtung. SAP kann als Technologiepartner diese Projekte sehr gut unterstützen. Wir liefern das technische Ökosystem, auf der viele lokale Betreiber oder Start-ups aufsetzen können, um Services zu erbringen. Diese Art der Vernetzung bringt die Digitalisierung nach vorne.
Vernetzung ist also nicht nur im technischen Sinn zu verstehen. Viele Player müssen auf dem Weg zur Smart City zusammenspielen. Wie kann das organisiert werden?
Tatsächlich geht es bei der Smart City darum, verschiedene Partner zusammenzubringen. Als Beispiele möchte ich die Digitalstadt GmbH in Darmstadt und die Digital-Agentur der Stadt Heidelberg nennen. Diese Institutionen koordinieren die Smart-City-Projekte der Städte und verfolgen eine langfristige Vision für die Stadt der Zukunft. Ich halte es für ganz wichtig, dass die Kommunen diese Koordinationsrolle übernehmen. So können Kompetenzen und Know-how gebündelt und auch kurzfristig bestimmte Projekte umgesetzt werden.
Das heißt, die Kommunen sollten eine Projektstruktur schaffen, um die Umsetzung selbst in der Hand zu haben?
Ja, das ist empfehlenswert. Viele Ideen kann man von außen holen, aber die Kommunen sind verantwortlich dafür, welche Projekte umgesetzt werden. Und kleinere Städte setzen hier andere Schwerpunkte als Metropolen.
Wie beschreiben Sie den technologischen Unterbau der vernetzten Stadt?
Wie schon angesprochen, müssen zunächst die wesentlichen Prozesse digitalisiert werden, insbesondere die kommunalen Finanzprozesse. Auf integrierten Plattformen werden Daten und Geschäftsprozesse miteinander verknüpft. Damit hat man eine erste Schicht, um möglichst automatisierte Prozesse zu schaffen. Darauf aufsetzend können Analysewerkzeuge eingesetzt werden, die wiederum Entscheidungsgrundlagen liefern.
Was kann SAP hier anbieten?
SAP liefert mit der ERP-Lösung SAP S/4HANA und der Business Technology Platform sozusagen ein Gesamtpaket. Darauf können Kommunen mit verschiedenen SAP-Anwendungen aufsetzen, aber auch – und das ist ein wichtiger Punkt – andere Lösungen und Datenwelten integrieren. So hat der Kunde einerseits eine einheitliche Datenbasis, kann andererseits aber auch individuell agieren. Das ist unsere Idee: Die SAP-Plattform ist quasi das Herz, das den Pulsschlag generiert und die Daten in die richtigen Adern bringt, aber auch die Möglichkeit bietet, externe Anwendungen zu integrieren. Es ist wichtig, dass unsere Kunden hier flexibel agieren können und das ist mit den neuen Technologien deutlich einfacher geworden.
Bietet SAP also eine Art vorkonfiguriertes Smart-City-Paket an, mit dem sich Städte auf den Weg machen können?
Vorkonfiguriert würde ich das nicht nennen. Wir bieten Standard-Software an, in der kommunale Standardprozesse mit den entsprechenden Daten verknüpft werden. Entscheidend sind die enthaltenen Analysewerkzeuge, die bereits auf kommunale Prozesse angepasst sind. Darauf aufbauend kann man relativ einfach eigene Auswertungen und Dashboards generieren. Insofern kann man sagen, dass wir eine Basis-Software ausliefern, die jede Kommune sofort nutzen und an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen kann.
Stadtwerke können die Infrastruktur betreiben und technologische Plattformen bereitstellen. Welche Rolle spielen die kommunalen Unternehmen aus Ihrer Sicht?
Mit Stadtwerken verbindet SAP langjährige Partnerschaften. Viele Stadtwerke haben bereits eine Führungsrolle beim Thema Smart City übernommen. Sie entwickeln beispielsweise neue Mobilitätskonzepte oder bauen LoRaWAN-Netze auf, über die Sensoren wertvolle Daten liefern, etwa für Instandhaltungen. Gegenüber der Verwaltung haben Stadtwerke einen entscheidenden Vorteil: Der Kundengedanke spielt bei ihnen eine größere Rolle. Der Schulterschluss zwischen Verwaltung und kommunalem Betrieb ist sinnvoll, weil die Unternehmen die technischen Fähigkeiten haben und die Kundenperspektive besser einnehmen können. Aufgrund ihrer betriebswirtschaftlichen Kompetenzen sind die Stadtwerke für SAP die Kernpartner bei der Smart-City-Umsetzung. Die politische Willenserklärung zur vernetzten Stadt ist meist vorhanden, die Stadtwerke werden jedoch für den Erfolg der Smart-City-Projekte über die Förderperioden hinaus sorgen müssen.
„Wir machen mit den Daten unserer Kunden keine Geschäfte.“
Kommunen und Stadtwerke werden kommunale Daten nicht ohne weiteres profitorientierten Plattformbetreibern überlassen wollen. Wie tragen SAP-Lösungen dazu bei, Datensicherheit und digitale Souveränität zu gewährleisten?
Wir machen mit den Daten unserer Kunden keine Geschäfte, sondern wollen ihnen ermöglichen, alles aus ihren Daten herauszuholen, um ihr Business effizient zu gestalten. Auf dem Weg der digitalen Transformation gehen viele Kunden mit ihren Lösungen in die Cloud. Wir arbeiten mit großen Cloud-Anbietern zusammen, man kann unsere Lösungen aber auch in den SAP-eigenen Rechenzentren nutzen. So können wir der öffentlichen Hand sichere Services aus der Cloud anbieten, Datenschutz und Datensicherheit sind gewährleistet. SAP ist zudem an Projekten zur digitalen Souveränität beteiligt, etwa an GAIA-X, dem europäischen Projekt zum Aufbau einer sicheren und vertrauenswürdigen Dateninfrastruktur.
Dieser Beitrag ist im Spezial der Ausgabe September/Oktober 2021 von stadt+werk erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.
Duisburg: Smart City sucht Bürgerideen
[17.04.2025] Ihren Smart-City-Masterplan will die Stadt Duisburgs gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickeln. Noch bis Ende Mai können diese ihre Ideen online einbringen. Die Stadt will alle Vorschläge sichten, bewerten und, sofern möglich, in den neuen Masterplan einbringen. mehr...
Stuttgart: Smart-City-Masterplan in Arbeit
[16.04.2025] Unter Beteiligung der Stadtgesellschaft erarbeitet Stuttgart einen umfassenden Smart-City-Masterplan. In Workshops diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft entsprechende Ideen und Projekte. Online können außerdem Vorhaben bewertet und kommentiert werden. mehr...
Leipzig / Landau in der Pfalz: Modellstädte für KI-gestützte Verkehrssteuerung
[15.04.2025] Die Städte Leipzig und Landau in der Pfalz werden als Pilotregionen im Forschungsprojekt AIAMO (Artificial Intelligence And MObility) an der KI-gestützten Verkehrssteuerung arbeiten. Die Ergebnisse sollen auf kleine und mittlere Kommunen übertragbar sein. mehr...
Regionalkonferenz MPSC: Smart sein
[11.04.2025] Wie Städte digital und nachhaltig wachsen können, steht im Mittelpunkt der 22. Regionalkonferenz des Bundesprogramms Modellprojekte Smart Cities am 3. Juni 2025 in Halle (Saale). mehr...
Interkommunale Zusammenarbeit: Smarte Daten helfen Bauhöfen
[11.04.2025] Daten aus Sensoren und eine App unterstützen die Orte Nauheim, Trebur und Büttelborn dabei, Baumbewässerung und Streueinsätze gezielt zu planen und künftig auch die Beleuchtung bedarfsabhängig zu steuern. Die Kommunen haben das Projekt gemeinsam umgesetzt. mehr...
Digitale Verkehrssteuerung: KIMONO sorgt für Neustart
[10.04.2025] Kaiserslautern hat seiner verkehrstechnischen Infrastruktur bis 2033 eine umfassende Modernisierung und Digitalisierung verordnet. Von den im Rahmen des Projekts KIMONO entstehenden Lösungen können auch andere Kommunen profitieren. mehr...
Hamburg: Parkraum effizient prüfen
[09.04.2025] In Hamburg können Parkberechtigungen digital beantragt und von den Kontrollkräften online überprüft werden. In Zukunft sollen Scan-Fahrzeuge für noch mehr Effizienz bei der Parkraumkontrolle sorgen – vorausgesetzt, die rechtliche Grundlage wird geschaffen. mehr...
Kreis Hameln-Pyrmont: Smart City geht in Verlängerung
[09.04.2025] Der als Modellprojekt Smart Cities geförderte Kreis Hameln-Pyrmont hat die kostenneutrale Verlängerung der Projektlaufzeit um ein Jahr beantragt – mit Erfolg. Durch den zeitintensiven Abstimmungsbedarf wäre der ursprünglich vorgesehene Zeitraum bis Ende 2026 zu kurz für die Kommune gewesen. mehr...
Interkommunales Netzwerk: Mobiler in der Ortenau
[08.04.2025] Das Mobilitätsnetzwerk Ortenau setzt auf nachhaltige Verkehrslösungen und will die analoge sowie digitale Verkehrsinfrastruktur verbessern. Wie die 14 Kommunen vorgehen, erläutert Sarah Berberich, Geschäftsführerin des Beratungsunternehmens endura kommunal. mehr...
Wolfsburg: Mehr als ein Parkleitsystem
[07.04.2025] Die Stadt Wolfsburg plant – ergänzend zu den Informationen, die sie per App übermittelt – ein dynamisches Parkleitsystem in der Innenstadt. Dieses soll eine effiziente Verkehrssteuerung ermöglichen und darüber hinausgehende Informationen liefern, etwa zu Veranstaltungen. mehr...
Fraunhofer FOKUS: Digital Twin hilft beim Routing
[02.04.2025] Das Smart-Mobility-Team von Fraunhofer FOKUS hat im Projekt KIS’M eine Fahrrad-App entwickelt, die auf einem digitalen Zwilling des Berliner Straßenverkehrs basiert. Die App berücksichtigt individuelle Präferenzen bei der Routenplanung und bietet einen Ampelphasenassistenten. mehr...
Local Digital Twins Toolbox: EU-Projekt für Kommunen
[31.03.2025] Mit der Local Digital Twins Toolbox unterstützt die Europäische Kommission Kommunen bei der Einführung entsprechender Lösungen. Teilnehmende Städte und Gemeinden bekommen wichtige Werkzeuge an die Hand und werden individuell beraten. mehr...
Dresden: Website zu Smart-City-Projekten
[31.03.2025] Eine neue Website mit Informationen zu ihren Smart-City-Projekten hat die Stadt Dresden jetzt online gestellt. Zu den momentan 17 geförderten Vorhaben zählen unter anderem die Entwicklung eines interaktiven 3D-Stadtmodells und ein Testfeld für zukunftsfähige Verkehrsstrukturen. mehr...
Landkreis Wunsiedel: Digitaler Zwilling im Aufbau
[31.03.2025] Der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge soll einen Digitalen Zwilling bekommen. Die Ausschreibung für die Anschaffung der nötigen LoRaWAN-Technologie ist bereits gestartet. Erste Anwendungen sollen noch in diesem Jahr in Betrieb gehen, insbesondere im Bereich Katastrophenschutz. mehr...
Troisdorf: Mit der smarT:app die Freizeit gestalten
[28.03.2025] Die smarT:app der Stadt Troisdorf unterstützt Nutzende mit einer interaktiven Karte jetzt auch bei der Freizeitgestaltung. mehr...