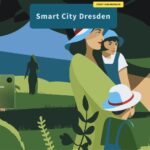InterviewSoftware-Silos aufbrechen

Dr. Ariane Berger
(Bildquelle: Privat)
Frau Dr. Berger, welche Bedeutung hat für Sie die Teilnahme an der diesjährigen Smart Country Convention?
Die diesjährige Smart Country Convention fällt in eine ungemein spannende Zeit. Das jüngst beschlossene Konjunkturpaket des Bundes beschleunigt Digitalisierungsprojekte in den verschiedensten Themenfeldern. Ein Schwerpunkt der diesjährigen Konferenz ist daher zu Recht erneut die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG), aber auch die Digitalisierung im Bereich Gesundheit. Besondere Bedeutung hat für uns als Deutscher Landkreistag die Adressierung des ländlichen Raums. Digitalisierung ist ein wesentlicher Treiber zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im ländlichen Raum.
Welche Erwartungen haben Sie an das digitale Format der SCC?
Die SCC bietet dieses Jahr ein interessantes Format, welches die Vorteile des persönlichen Austauschs mit den Erfordernissen pandemiebedingter Virtualität kombiniert. Ich bin gespannt, wie sich das bewährt.
Sie vergleichen die Kommunen mit Blick auf den Stand der OZG-Umsetzung mit vielen bunten Blumen. Warum?
Deutschland baut Software-Lösungen für die öffentliche Verwaltung auf allen föderalen Ebenen. Insbesondere die Kommunen, Hauptvollzugsebene in Deutschland, verfügen über eine Vielzahl verschiedener digitaler Lösungen. Dies betrifft den OZG-Bereich ebenso wie den Bereich der digitalen Daseinsvorsorge, das heißt insbesondere Bildung, Gesundheit und Mobilität. Bislang stehen diese digitalen Lösungen jedoch regelmäßig vereinzelt für sich, ohne dass eine echte Arbeitsteilung und ein Austausch von Software-Lösungen untereinander, also Nachnutzung, stattfindet. Das ist ineffizient und teuer.
„Die OZG-Umsetzung kann nur gelingen, wenn der alte Musketieransatz konsequent umgesetzt wird: Einer für alle!“
Lässt sich ein Weg finden, mit dem Kommunen und Länder nicht nur innerhalb ihrer eigenen IT-Landschaft Lösungen entwickeln, um Verwaltungsleistungen digital verfügbar zu machen?
Der IT-Planungsrat hat jüngst beschlossen, dass die finanzielle Unterstützung der Länder aus dem Konjunkturpaket im Rahmen der OZG-Umsetzung an den Grundsatz ‚einer für alle‘ geknüpft ist. Das ist ein richtiger erster Schritt. Diese zentrale Bedingung muss nun mit Leben erfüllt werden. Dies setzt neben dem politischen Willen in den Ländern und der entsprechenden Finanzierung, die bei den Kommunen ankommen muss, auch ein umfassendes Nachnutzungskonzept voraus. Hier geht es um die Schaffung einheitlicher Standards und Schnittstellen und eine Öffnung der bislang geschlossenen Portallandschaft in den Ländern.
Welche Rolle spielen dabei Entwicklungsgemeinschaften und Austauschplattformen?
Ziel muss es sein, dass Bund, Länder und Kommunen gemeinsam und länderübergreifend Software-Lösungen entwickeln. Nur so ist sichergestellt, dass das entstehende Software-Produkt nicht nur die Erfordernisse der jeweiligen IT-Landschaft erfüllt, sondern hochgradig kompatibel ist. Entwicklungsgemeinschaften befördern Standardisierung und Interoperabilität. Die dann hoffentlich in großer Menge entstehenden Software-Lösungen müssen allen zur Verfügung gestellt werden. Hierzu bedarf es neben rechtlicher Rahmenbedingungen einer oder mehrerer technischer Austauschplattformen, über die auf die digitalen Lösungen zugegriffen werden kann.
Der Deutsche Landkreistag fordert Microservices als Standard für neue Software. Was verstehen Sie darunter?
Der Begriff Microservices beschreibt modulare, gekapselte und damit hochgradig lauffähige Software. Vereinfachend lassen sich Microservices als ‚Software-Schnipsel‘ beschreiben, die sich in die jeweilige IT-Landschaft einfügen lassen. Sie sind damit ein Instrument, um Software-Silos aufzubrechen und Nachnutzung zu ermöglichen. Sie ergänzen in ihrer Funktion die klassischen XÖV-Standards des IT-Planungsrats.
Der IT-Planungsrat hat die Einrichtung des FIT-Stores, eines App-Stores für die öffentliche Verwaltung, angekündigt. Wie bewerten Sie diese Pläne?
Der Begriff FIT-Store beschreibt zunächst einmal ein vergaberechtliches Instrument, welches es Bund und Ländern rechtlich ermöglichen soll, digitale Lösungen untereinander auszutauschen. Die Föderale IT-Kooperation (FITKO) soll als Inhouse-Gesellschaft dienen. Dass vergaberechtliche Hürden den Austausch von digitalen Lösungen zwischen öffentlichen Auftraggebern erschweren, ist unbestritten. Insoweit ist ein gemeinsames Regelwerk zu befürworten. Der Deutsche Landkreistag fordert hier die unmittelbare Einbindung der Kommunen. Der FIT-Store kann eine sinnvolle Ergänzung zu den bisherigen Wegen der IT-Beschaffung in den Kommunen darstellen.
Was steht einer länderübergreifenden Kooperation in Bezug bei der OZG-Umsetzung im Weg?
Hier spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Neben der bestehenden heterogenen Anbieterlandschaft im Bereich IT, die regional begrenzt ist und ihre eigenen Geschäftsinteressen verfolgt, ist auch der technische Aspekt der Interoperabilität nicht banal. Letztlich ist es ein kulturelles Problem. Länderübergreifende Kooperation in diesem Ausmaß – also nicht nur singulär in einzelnen Aufgabenbereichen und Projekten, sondern in allen Themenfeldern der öffentlichen Verwaltung und langfristig angelegt – ist insbesondere für Bund und Länder neu und muss erst eingeübt werden.
Welche Vorteile hat es für die Kommunen, wenn IT-Lösungen bundesweit verfügbar werden?
Die Kommunen stehen vor der riesigen Herausforderung, digitale Lösungen selbst zu entwickeln oder entwickeln zu lassen, diese mit den bestehenden digitalen Prozessen im eigenen Haus zu verknüpfen und zugleich einen Anschluss an die eigenen Verwaltungsportale und die Länderportale sicherzustellen. Diese Entwicklungs- und Integrationsleistung ist eine höchst kostenintensive Mammutaufgabe und betrifft alle Aufgabenfelder gleichermaßen. Die Kommunen sind daher darauf angewiesen, dass Lösungen leicht integrierbar sind und die Kosten hierfür im Rahmen bleiben. Hier kann Anbietervielfalt und Wettbewerb nur helfen.
Was muss in der verbleibenden Zeit noch geschehen, damit die OZG-Umsetzung rechtzeitig und erfolgreich gemeistert werden kann?
Eine rechtzeitige und erfolgreiche OZG-Umsetzung kann nur gelingen, wenn der alte Musketieransatz konsequent umgesetzt wird: Einer für alle!
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe Oktober 2020 von Kommune21 im Schwerpunkt Smart Country Convention erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.
Duisburg: Smart City sucht Bürgerideen
[17.04.2025] Ihren Smart-City-Masterplan will die Stadt Duisburgs gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickeln. Noch bis Ende Mai können diese ihre Ideen online einbringen. Die Stadt will alle Vorschläge sichten, bewerten und, sofern möglich, in den neuen Masterplan einbringen. mehr...
Stuttgart: Smart-City-Masterplan in Arbeit
[16.04.2025] Unter Beteiligung der Stadtgesellschaft erarbeitet Stuttgart einen umfassenden Smart-City-Masterplan. In Workshops diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft entsprechende Ideen und Projekte. Online können außerdem Vorhaben bewertet und kommentiert werden. mehr...
Leipzig / Landau in der Pfalz: Modellstädte für KI-gestützte Verkehrssteuerung
[15.04.2025] Die Städte Leipzig und Landau in der Pfalz werden als Pilotregionen im Forschungsprojekt AIAMO (Artificial Intelligence And MObility) an der KI-gestützten Verkehrssteuerung arbeiten. Die Ergebnisse sollen auf kleine und mittlere Kommunen übertragbar sein. mehr...
Regionalkonferenz MPSC: Smart sein
[11.04.2025] Wie Städte digital und nachhaltig wachsen können, steht im Mittelpunkt der 22. Regionalkonferenz des Bundesprogramms Modellprojekte Smart Cities am 3. Juni 2025 in Halle (Saale). mehr...
Interkommunale Zusammenarbeit: Smarte Daten helfen Bauhöfen
[11.04.2025] Daten aus Sensoren und eine App unterstützen die Orte Nauheim, Trebur und Büttelborn dabei, Baumbewässerung und Streueinsätze gezielt zu planen und künftig auch die Beleuchtung bedarfsabhängig zu steuern. Die Kommunen haben das Projekt gemeinsam umgesetzt. mehr...
Digitale Verkehrssteuerung: KIMONO sorgt für Neustart
[10.04.2025] Kaiserslautern hat seiner verkehrstechnischen Infrastruktur bis 2033 eine umfassende Modernisierung und Digitalisierung verordnet. Von den im Rahmen des Projekts KIMONO entstehenden Lösungen können auch andere Kommunen profitieren. mehr...
Hamburg: Parkraum effizient prüfen
[09.04.2025] In Hamburg können Parkberechtigungen digital beantragt und von den Kontrollkräften online überprüft werden. In Zukunft sollen Scan-Fahrzeuge für noch mehr Effizienz bei der Parkraumkontrolle sorgen – vorausgesetzt, die rechtliche Grundlage wird geschaffen. mehr...
Kreis Hameln-Pyrmont: Smart City geht in Verlängerung
[09.04.2025] Der als Modellprojekt Smart Cities geförderte Kreis Hameln-Pyrmont hat die kostenneutrale Verlängerung der Projektlaufzeit um ein Jahr beantragt – mit Erfolg. Durch den zeitintensiven Abstimmungsbedarf wäre der ursprünglich vorgesehene Zeitraum bis Ende 2026 zu kurz für die Kommune gewesen. mehr...
Interkommunales Netzwerk: Mobiler in der Ortenau
[08.04.2025] Das Mobilitätsnetzwerk Ortenau setzt auf nachhaltige Verkehrslösungen und will die analoge sowie digitale Verkehrsinfrastruktur verbessern. Wie die 14 Kommunen vorgehen, erläutert Sarah Berberich, Geschäftsführerin des Beratungsunternehmens endura kommunal. mehr...
Wolfsburg: Mehr als ein Parkleitsystem
[07.04.2025] Die Stadt Wolfsburg plant – ergänzend zu den Informationen, die sie per App übermittelt – ein dynamisches Parkleitsystem in der Innenstadt. Dieses soll eine effiziente Verkehrssteuerung ermöglichen und darüber hinausgehende Informationen liefern, etwa zu Veranstaltungen. mehr...
Fraunhofer FOKUS: Digital Twin hilft beim Routing
[02.04.2025] Das Smart-Mobility-Team von Fraunhofer FOKUS hat im Projekt KIS’M eine Fahrrad-App entwickelt, die auf einem digitalen Zwilling des Berliner Straßenverkehrs basiert. Die App berücksichtigt individuelle Präferenzen bei der Routenplanung und bietet einen Ampelphasenassistenten. mehr...
Local Digital Twins Toolbox: EU-Projekt für Kommunen
[31.03.2025] Mit der Local Digital Twins Toolbox unterstützt die Europäische Kommission Kommunen bei der Einführung entsprechender Lösungen. Teilnehmende Städte und Gemeinden bekommen wichtige Werkzeuge an die Hand und werden individuell beraten. mehr...
Dresden: Website zu Smart-City-Projekten
[31.03.2025] Eine neue Website mit Informationen zu ihren Smart-City-Projekten hat die Stadt Dresden jetzt online gestellt. Zu den momentan 17 geförderten Vorhaben zählen unter anderem die Entwicklung eines interaktiven 3D-Stadtmodells und ein Testfeld für zukunftsfähige Verkehrsstrukturen. mehr...
Landkreis Wunsiedel: Digitaler Zwilling im Aufbau
[31.03.2025] Der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge soll einen Digitalen Zwilling bekommen. Die Ausschreibung für die Anschaffung der nötigen LoRaWAN-Technologie ist bereits gestartet. Erste Anwendungen sollen noch in diesem Jahr in Betrieb gehen, insbesondere im Bereich Katastrophenschutz. mehr...
Troisdorf: Mit der smarT:app die Freizeit gestalten
[28.03.2025] Die smarT:app der Stadt Troisdorf unterstützt Nutzende mit einer interaktiven Karte jetzt auch bei der Freizeitgestaltung. mehr...