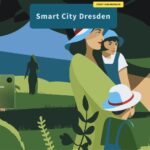NürnbergVision der Stadt

Nürnberg: Gemeinschaftsprojekt Smart City.
(Bildquelle: Ramboll)
Digitale Verwaltungsprozesse, stabile Internet-Verbindungen im Homeoffice, Unterricht im virtuellen Raum oder Onlineshops des lokalen Einzelhandels – die Corona-Krise hat gezeigt, wie viel Nachholbedarf wir hierzulande im Bereich Digitalisierung haben. Durch die Erfahrungen der vergangenen Monate ist das Bewusstsein um die Bedeutung der Digitalisierung enorm gestiegen. Viele Kommunen denken um. Ging es lange Jahre noch immer um das Ob der Digitalisierung, diskutieren die Verantwortlichen spätestens jetzt über das Wie. Immer mehr Städte schlagen dabei den Weg Richtung Smart City ein und zielen mit ganzheitlichen, integrierten Entwicklungskonzepten darauf ab, das Leben in der Stadt smart zu gestalten – also nachhaltiger, energie- und ressourceneffizienter, technologisch innovativer, wirtschaftlich wettbewerbsfähiger und sozial inklusiver.
Silodenken überwinden
Dabei gilt es nicht nur, den technischen Wandel voranzutreiben, sondern vor allem auch althergebrachte Arbeitsweisen hinter sich zu lassen und neue, digitale Herangehensweisen zu etablieren. Denn viele Verwaltungen arbeiten bislang in traditionell gewachsenen, separaten Silos. Das heißt, einzelne Geschäftsbereiche der Verwaltungen, wie Mobilität, Bildung und Energiewirtschaft, sind streng nach Verantwortlichkeiten getrennt. Die Digitalisierung ist jedoch ein über alle Fachbereiche reichendes Querschnittsthema. Von der Stadtverwaltung über Wirtschaft, Wissenschaft und Bildungseinrichtungen bis hin zum privaten Lebensumfeld – eine nachhaltige smarte Stadtentwicklung erfordert eine gemeinsame Vision aller Beteiligten. Grundstein dafür ist das Bewusstsein, dass es sich bei der Digitalisierung um einen Standortfaktor für Kommunen handelt. Wichtig ist zudem der Wille, die anfänglich hohen Investitionen in die digitale Infrastruktur zu tragen. Die Digitalisierung erfordert von kommunalen Verantwortlichen also insgesamt viel Mut zu neuen Wegen.
Nachhaltig in die Zukunft
Die dänische Ingenieur- und Management-Beratung Ramboll beschäftigt sich seit Langem mit der Entwicklung und Umsetzung von Smart-City-Strategien für Kommunen. Mit einem breit aufgestellten Branchen- und Kompetenzspektrum bündelt das Unternehmen alle Leistungen in einer Hand, entwickelt ganzheitliche Ansätze und setzt in hohem Maß auf Kommunikation mit den Betroffenen sowie den Bürgern. Dabei greifen die Experten auch auf das Wissen aus den Nachbarländern Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland zurück. Denn in den Bereichen Open Data, Smart Mobility, digitale Bildung oder auch smarte Stromnetze sind die nordischen Kommunen den deutschen um einige Jahre voraus. Entscheidend war aber auch in den skandinavischen Ländern stets ein gemeinsames Verständnis von digitaler Transformation und deren Chancen für die Stadtgesellschaft.
#bild2 Den Beweis, wie eine Stadt in Deutschland nachhaltige Schritte in Richtung digitale Zukunft machen kann, liefert aktuell Nürnberg. Im Jahr 2019 hat die fränkische Metropole gemeinsam mit Ramboll die Dachstrategie Digitales Nürnberg entwickelt. Sie zielt darauf ab, die Lebensqualität für alle Bürger mithilfe neuer Technologien zu heben und gleichzeitig die Bedeutung der Stadt als digitaler Standort zu stärken. Im Herbst vergangenen Jahres gab der Nürnberger Stadtrat mit der Verabschiedung der strategischen Leitlinien den Startschuss für die Dachstrategie. Die Leitlinien definieren die Vision der Stadt sowie die Ziele und Handlungsfelder für die digitale Entwicklung. Darauf aufbauend entstand in Zusammenarbeit mit den Beratern von Ramboll eine Roadmap. Sie macht die Innovationspotenziale für die Stadt sichtbar, liefert konkrete Umsetzungsvorschläge und dient somit allen Verantwortlichen als Kompass für die Gestaltung des digitalen Nürnbergs.
Eine ganzheitliche Betrachtung
Der Roadmap ging ein zwölfmonatiger Partizipationsprozess mit Unterstützung der Bürgerbeteiligungsexperten von Ramboll voraus. Denn die Bewohner müssen bei digitalen Vorhaben als Nutzer sowie Kunden im Mittelpunkt der Entwicklungen stehen. Wo Digitalisierung nicht auf echten Bedarf und hohe Akzeptanz trifft, wird sie nicht funktionieren. Mit dem Ziel, den Diskurs zu fördern und den Austausch mit Fachleuten zu ermöglichen, wurden daher in Nürnberg neben einer öffentlichen Informationsveranstaltung vier Fokusgruppenworkshops mit Experten sowie Fachinterviews durchgeführt. Bürger konnten ihre Bedürfnisse zudem in zwei aufeinander aufbauenden Online-Beteiligungsformaten kundtun und wurden somit direkt in den Entstehungsprozess der Roadmap eingebunden. In einer Online-Blitzumfrage hatten die Teilnehmenden zunächst die Möglichkeit, Themen anzugeben, die eine wichtige Rolle bei der digitalen Entwicklung der Stadt Nürnberg spielen sollten. Die Ergebnisse der Blitzumfrage und einer analogen Dialogveranstaltung wurden anschließend als Grundlage für eine weitere vierwöchige E-Partizipation genutzt, in der die Bürger sowohl bestehende Beiträge und Ideen kommentieren als auch neue Vorschläge einreichen konnten. So entstand eine Roadmap, die digitale Innovationen nicht auf einzelne Akteure oder Geschäftsbereiche beschränkt, sondern Themen- und Handlungsfelder ganzheitlich und vernetzt betrachtet.
Ressourcen und Herausforderungen
Die Roadmap erkennt zum einen die vorhandenen Ressourcen der Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft als Kapital der Zukunft an und identifiziert andererseits Herausforderungen und Zukunftstrends für die einzelnen Themen der Stadtentwicklung. In fünf übergeordneten Themenfeldern wurden für Nürnberg 13 konkrete Handlungsempfehlungen formuliert, die nun Schritt für Schritt in die Umsetzung überführt werden. Vom Aufbau einer digitalen Mobilitätsplattform über jährliche Digitalforen, in denen Familien ihre Wünsche zur digitalen Alltagsunterstützung mit Experten sowie der Stadtverwaltung diskutieren können, bis hin zu Reallaboren zur transdisziplinären Forschung nachhaltiger Lebens- und Wirtschaftsformen geht Nürnberg mutig den Weg in Richtung Smart City.
Verwaltung als treibende Kraft
Klassische Hemmnisse der Digitalisierung von Kommunen sind hierzulande fehlende Finanzmittel und fehlendes Wissen über Fördermöglichkeiten sowie rechtliche Hürden und ein Mangel an digitaler Kompetenz in den Verwaltungen. Viele Kommunen brauchen zum Beispiel Unterstützung, um sich im Förderdschungel und bei Finanzierungsfragen zurechtzufinden. Zudem fehlt oft schlichtweg die digitale Infrastruktur vor Ort. Schonungslos legt die Corona-Krise beispielsweise die Lücken in digitalen Bildungskonzepten und dem Ausbau digitaler Verwaltungen in Deutschland offen. Die Chance liegt jetzt darin, als Kommune ein neues Selbstverständnis zu entwickeln und Verwaltung selbst als treibende Kraft für digitale Lösungen zu verstehen. Engere Kooperationen von Wissenschaft und Wirtschaft sowie die Beteiligung und Information der Zivilgesellschaft helfen dabei, die komplexen Kompetenzfelder zu erschließen und langfristig zu digitalisieren. Der ganzheitliche Ansatz der digitalen Stadtentwicklung ermöglicht es außerdem, das Thema Nachhaltigkeit wieder stärker in den Blick zu nehmen und bestmöglich mit digitalen Lösungen zu unterstützen. Nürnberg verfolgt entsprechende Ziele beispielsweise durch den Aufbau einer digitalen Mobilitätsplattform. So steigern Kommunen nicht nur die Lebensqualität für ihre Bürger, sondern werden gleichzeitig zum attraktiven Wirtschaftsstandort für Unternehmen.
https://de.ramboll.com
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe August 2020 von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren.
Duisburg: Smart City sucht Bürgerideen
[17.04.2025] Ihren Smart-City-Masterplan will die Stadt Duisburgs gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickeln. Noch bis Ende Mai können diese ihre Ideen online einbringen. Die Stadt will alle Vorschläge sichten, bewerten und, sofern möglich, in den neuen Masterplan einbringen. mehr...
Stuttgart: Smart-City-Masterplan in Arbeit
[16.04.2025] Unter Beteiligung der Stadtgesellschaft erarbeitet Stuttgart einen umfassenden Smart-City-Masterplan. In Workshops diskutieren Vertreterinnen und Vertreter aus Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft entsprechende Ideen und Projekte. Online können außerdem Vorhaben bewertet und kommentiert werden. mehr...
Leipzig / Landau in der Pfalz: Modellstädte für KI-gestützte Verkehrssteuerung
[15.04.2025] Die Städte Leipzig und Landau in der Pfalz werden als Pilotregionen im Forschungsprojekt AIAMO (Artificial Intelligence And MObility) an der KI-gestützten Verkehrssteuerung arbeiten. Die Ergebnisse sollen auf kleine und mittlere Kommunen übertragbar sein. mehr...
Regionalkonferenz MPSC: Smart sein
[11.04.2025] Wie Städte digital und nachhaltig wachsen können, steht im Mittelpunkt der 22. Regionalkonferenz des Bundesprogramms Modellprojekte Smart Cities am 3. Juni 2025 in Halle (Saale). mehr...
Interkommunale Zusammenarbeit: Smarte Daten helfen Bauhöfen
[11.04.2025] Daten aus Sensoren und eine App unterstützen die Orte Nauheim, Trebur und Büttelborn dabei, Baumbewässerung und Streueinsätze gezielt zu planen und künftig auch die Beleuchtung bedarfsabhängig zu steuern. Die Kommunen haben das Projekt gemeinsam umgesetzt. mehr...
Digitale Verkehrssteuerung: KIMONO sorgt für Neustart
[10.04.2025] Kaiserslautern hat seiner verkehrstechnischen Infrastruktur bis 2033 eine umfassende Modernisierung und Digitalisierung verordnet. Von den im Rahmen des Projekts KIMONO entstehenden Lösungen können auch andere Kommunen profitieren. mehr...
Hamburg: Parkraum effizient prüfen
[09.04.2025] In Hamburg können Parkberechtigungen digital beantragt und von den Kontrollkräften online überprüft werden. In Zukunft sollen Scan-Fahrzeuge für noch mehr Effizienz bei der Parkraumkontrolle sorgen – vorausgesetzt, die rechtliche Grundlage wird geschaffen. mehr...
Kreis Hameln-Pyrmont: Smart City geht in Verlängerung
[09.04.2025] Der als Modellprojekt Smart Cities geförderte Kreis Hameln-Pyrmont hat die kostenneutrale Verlängerung der Projektlaufzeit um ein Jahr beantragt – mit Erfolg. Durch den zeitintensiven Abstimmungsbedarf wäre der ursprünglich vorgesehene Zeitraum bis Ende 2026 zu kurz für die Kommune gewesen. mehr...
Interkommunales Netzwerk: Mobiler in der Ortenau
[08.04.2025] Das Mobilitätsnetzwerk Ortenau setzt auf nachhaltige Verkehrslösungen und will die analoge sowie digitale Verkehrsinfrastruktur verbessern. Wie die 14 Kommunen vorgehen, erläutert Sarah Berberich, Geschäftsführerin des Beratungsunternehmens endura kommunal. mehr...
Wolfsburg: Mehr als ein Parkleitsystem
[07.04.2025] Die Stadt Wolfsburg plant – ergänzend zu den Informationen, die sie per App übermittelt – ein dynamisches Parkleitsystem in der Innenstadt. Dieses soll eine effiziente Verkehrssteuerung ermöglichen und darüber hinausgehende Informationen liefern, etwa zu Veranstaltungen. mehr...
Fraunhofer FOKUS: Digital Twin hilft beim Routing
[02.04.2025] Das Smart-Mobility-Team von Fraunhofer FOKUS hat im Projekt KIS’M eine Fahrrad-App entwickelt, die auf einem digitalen Zwilling des Berliner Straßenverkehrs basiert. Die App berücksichtigt individuelle Präferenzen bei der Routenplanung und bietet einen Ampelphasenassistenten. mehr...
Local Digital Twins Toolbox: EU-Projekt für Kommunen
[31.03.2025] Mit der Local Digital Twins Toolbox unterstützt die Europäische Kommission Kommunen bei der Einführung entsprechender Lösungen. Teilnehmende Städte und Gemeinden bekommen wichtige Werkzeuge an die Hand und werden individuell beraten. mehr...
Dresden: Website zu Smart-City-Projekten
[31.03.2025] Eine neue Website mit Informationen zu ihren Smart-City-Projekten hat die Stadt Dresden jetzt online gestellt. Zu den momentan 17 geförderten Vorhaben zählen unter anderem die Entwicklung eines interaktiven 3D-Stadtmodells und ein Testfeld für zukunftsfähige Verkehrsstrukturen. mehr...
Landkreis Wunsiedel: Digitaler Zwilling im Aufbau
[31.03.2025] Der Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge soll einen Digitalen Zwilling bekommen. Die Ausschreibung für die Anschaffung der nötigen LoRaWAN-Technologie ist bereits gestartet. Erste Anwendungen sollen noch in diesem Jahr in Betrieb gehen, insbesondere im Bereich Katastrophenschutz. mehr...
Troisdorf: Mit der smarT:app die Freizeit gestalten
[28.03.2025] Die smarT:app der Stadt Troisdorf unterstützt Nutzende mit einer interaktiven Karte jetzt auch bei der Freizeitgestaltung. mehr...