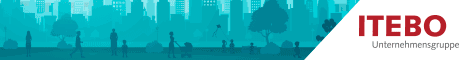Capgemini-Studie:
Datenökosysteme in der Verwaltung
[1.2.2023] Gemeinsame Datenökosysteme helfen der öffentlichen Verwaltung, auf systemische Herausforderungen zu reagieren. Eine breite Akzeptanz fehlt jedoch noch, ebenso wie wichtige Technologien. Dies sind die Kernergebnisse einer aktuellen Studie des Beratungsunternehmens Capgemini.
Die überwiegende Mehrheit der Organisationen im öffentlichen Sektor hat erkannt, dass zur Bewältigung komplexer gesellschaftlicher Herausforderungen ein gemeinsamer, datengestützter Ansatz notwendig ist. Neben der Verfügbarkeit notwendiger Technologie bestehen aber vor allem noch Herausforderungen im Hinblick auf Kultur und Vertrauen. Dies sind die Ergebnisse der globalen Studie „Connecting the Dots: Data sharing in the public sector“, die das Capgemini Research Institute jetzt publiziert hat. Demnach haben 80 Prozent der Organisationen weltweit bereits damit begonnen, Initiativen für kollaborative Datenökosysteme umzusetzen. Allerdings befinden sich nach Einschätzung des Beratungsunternehmens die meisten Organisationen der öffentlichen Verwaltung noch in der Anfangsphase der Umsetzung und nur wenige haben bislang Datenökosysteme in größerem Umfang eingeführt.
Effektiver Datenaustausch
Capgemini definiert ein Datenökosystem des öffentlichen Sektors als ein „System der Datenzusammenarbeit, an dem eine öffentliche Organisation zusammen mit anderen privaten oder öffentlichen Organisationen oder Bürgern beteiligt ist“. Solche kollaborativen Datenökosysteme unterstützen Organisationen des öffentlichen Sektors weltweit in wichtigen Funktionsbereichen wie etwa Verwaltung, Sicherheit, Steuern und soziale Dienste. So ergab die Studie, dass 81 Prozent der Kommunal-, Landes- und Zentralverwaltungen, die Datenökosysteme eingeführt haben oder dies planen, ein stärkeres Engagement der Bürger beobachten konnten. 69 Prozent konnten ihre Nachhaltigkeits-Roadmap optimieren. Zudem gaben 93 Prozent der Befragten an, dass die Transparenz der Verwaltung verbessert wurde. Auch Bürger profitieren von verbesserten staatlichen Leistungen, beispielsweise von einer gezielteren Bereitstellung von Sozialleistungen für besonders bedürftige Menschen sowie von einer höheren öffentlichen Sicherheit. So hatten Polizeibehörden insbesondere eine bessere Rechtsdurchsetzung und kürzere Reaktionszeiten als Vorteile von Datenökosystemen genannt. 74 Prozent der Organisationen des öffentlichen Sektors sehen eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Cyber-Bedrohungen.
Kulturwandel und Vertrauensbildung notwendig
Einer breiteren Einführung von Datenökosystemen stehen laut der Studie derzeit vor allem mangelndes Vertrauen der Beteiligten und eine unzureichend entwickelte Kultur in den Organisationen entgegen. So sehen sich 56 Prozent der Befragten mit verschiedenen Herausforderungen in Bezug auf das Vertrauen der Mitarbeitenden und Bürger konfrontiert. Dazu gehören unter anderem der Widerstand von Bürgern gegen die Weitergabe von Daten sowie mangelndes Vertrauen in die Datenqualität.
Die Studie unterstreicht insbesondere die zentrale Rolle der Mitarbeitenden im öffentlichen Sektor. Die Verwaltung müsse eine datengetriebene Kultur sowie die dafür notwendigen Kompetenzen in ihren Organisationen gezielt fördern, so Capgemini in einem Resümee. Außerdem müsse sie ein ganzheitliches Qualifizierungsprogramm entwickeln, um ihre Mitarbeitenden mit den notwendigen Fähigkeiten in den Bereichen Daten-Management und künstliche Intelligenz sowie im Umgang mit Datenschutzfragen auszustatten. Nur 55 Prozent der Organisationen gaben in der Studie an, ihre Mitarbeitenden im ethischen Umgang mit Bürgerdaten geschult zu haben.
Datenschutz-Technologien schaffen Vertrauen
Für den Erfolg kollaborativer Datenökosysteme sei es entscheidend, Sicherheit und Datenschutz von Grund auf einzubetten, stellt Capgemini fest. Dann könnten öffentliche Organisationen die Vorteile der gemeinsamen Datennutzung mit der Notwendigkeit des Datenschutzes in Einklang bringen. Dies erfordere auch die Entwicklung solider Governance-Strukturen, Data-Mesh-Architekturen sowie den Einsatz von Technologien zum Schutz der Privatsphäre, darunter Differential Privacy, föderiertes Lernen und homomorphe Verschlüsselung.
Für die Studie befragte das Capgemini Research Institute 1.000 leitende Mitarbeitende in Organisationen des öffentlichen Sektors aus 12 Ländern in Nordamerika, Europa und Asien, die an Datenökosystemen arbeiten oder dies planen. Zudem wurden ausführliche Interviews mit mehr als 20 Führungskräften des öffentlichen Sektors und Akademikern durchgeführt. (sib)
https://www.capgemini.com/de
Capgemini-Studie „Connecting the dots. Data sharing in the public sector“ (PDF, 13 MB) (Deep Link)
Stichwörter: Open Government, Capgemini, Studie
Anzeige
Weitere Meldungen und Beiträge aus dem Bereich Open Government
Open Data: Ideen für ländliche Kommunen gesucht
[20.6.2024] Innovative Lösungen zum Einsatz von offenen Verwaltungsdaten in ländlichen Kommunen sucht jetzt das Bundeslandwirtschaftsministerium im Zuge eines Ideenwettbewerbs. mehr...
[20.6.2024] Innovative Lösungen zum Einsatz von offenen Verwaltungsdaten in ländlichen Kommunen sucht jetzt das Bundeslandwirtschaftsministerium im Zuge eines Ideenwettbewerbs. mehr...
Dresden: Digitale Lösungen gegen Extremwetter
[16.5.2024] Beim diesjährigen Open Data Camp der Stadt Dresden und der Sächsischen Staatskanzlei sollen die Teilnehmenden unter dem Motto „Cool down – Hack die Extreme“ kreative digitale Lösungen zur Anpassung an Extremwetterlagen entwickeln. mehr...
[16.5.2024] Beim diesjährigen Open Data Camp der Stadt Dresden und der Sächsischen Staatskanzlei sollen die Teilnehmenden unter dem Motto „Cool down – Hack die Extreme“ kreative digitale Lösungen zur Anpassung an Extremwetterlagen entwickeln. mehr...
Bayern: Kompetenz für Open Data
[10.5.2024] Ein Kompetenzzentrum für Open Data wollen in Bayern das Digitalministerium und die Digitalagentur byte etablieren. Das Portfolio des Kompetenzzentrums umfasst neben dem Open-Data-Portal umfassende Serviceleistungen, die den Einstieg in die Datenbereitstellung auch für kleinste Behörden und Kommunen möglich machen. mehr...
[10.5.2024] Ein Kompetenzzentrum für Open Data wollen in Bayern das Digitalministerium und die Digitalagentur byte etablieren. Das Portfolio des Kompetenzzentrums umfasst neben dem Open-Data-Portal umfassende Serviceleistungen, die den Einstieg in die Datenbereitstellung auch für kleinste Behörden und Kommunen möglich machen. mehr...
Open Government: Haushaltsdaten digital veröffentlichen
Bericht
[3.5.2024] Neben der Haushaltssatzung sollten die Bürgerinnen und Bürger auch auf den kommunalen Haushaltsplan jederzeit unkompliziert zugreifen können. Es empfiehlt sich deshalb die Online-Veröffentlichung. Der Einsatz digitaler Methoden sorgt darüber hinaus für mehr Transparenz und bessere Auswertungsmöglichkeiten. mehr...
[3.5.2024] Neben der Haushaltssatzung sollten die Bürgerinnen und Bürger auch auf den kommunalen Haushaltsplan jederzeit unkompliziert zugreifen können. Es empfiehlt sich deshalb die Online-Veröffentlichung. Der Einsatz digitaler Methoden sorgt darüber hinaus für mehr Transparenz und bessere Auswertungsmöglichkeiten. mehr...
Open Data Barcamp: Raum für Austausch und Networking
[11.3.2024] Das Open Data Barcamp bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und sich im Bereich Open Data auszutauschen. Das Besondere: Sie haben die Möglichkeit, das Programm selbst zu gestalten. mehr...
[11.3.2024] Das Open Data Barcamp bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und sich im Bereich Open Data auszutauschen. Das Besondere: Sie haben die Möglichkeit, das Programm selbst zu gestalten. mehr...
Weitere FirmennewsAnzeige
Besuchersteuerung: Das neue Einbürgerungsgesetz stellt Behörden vor zusätzliche Herausforderungen
[12.6.2024] Am 27. Juni 2024 tritt das neue deutsche Einbürgerungsgesetz in Kraft. Damit verkürzt sich die Mindestaufenthaltsdauer für eine Einbürgerung von derzeit acht auf fünf Jahre, bei besonderen Integrationsleistungen sogar auf bis zu drei Jahre. Demzufolge werden Ausländerbehörden künftig mehr Anträge auf Einbürgerung bearbeiten müssen. Allerdings stoßen bereits heute viele Ausländerbehörden an ihre Kapazitätsgrenzen. Magdalene Rottstegge, zuständig für das Business Development bei der SMART CJM GmbH, erläutert, wie Ämter das erhöhte Arbeitsaufkommen besser bewältigen können. mehr...
E-Rechnung: Für den Ansturm rüsten
[31.5.2024] Die E-Rechnungspflicht im B2B-Bereich kommt. Kommunen sollten jetzt ihre IT darauf ausrichten. Ein Sechs-Stufen-Plan, der als roter Faden Wege und technologische Lösungsmöglichkeiten aufzeigt, kann dabei helfen. mehr...
Suchen...
Anzeige
Aboverwaltung
Aktuelle Meldungen