Ländlicher Raum:
Digitale Landlust
[15.8.2023] Co-Working-Spaces und Zwischennutzungsinitiativen sind vielerorts Vorboten einer neuen digitalen Landlust. Digitalarbeiter aus den Großstädten entdecken dadurch den ländlichen Raum und bleiben dort – wenn die Rahmenbedingungen passen.
 Alte Wohnzimmersessel, Lampenschirme mit Quasten, zusammengesteckte Schreibtische aus MDF, bunte Teppiche, Zimmerpflanzen und ein abgestelltes Fahrrad – dieser Co-Working-Space kommt dem eigenen Klischee recht nahe. Auf der großzügigen Fabriketage stehen 15 locker verteilte Arbeitsplätze mit Computer-Monitoren und Druckeranschluss. Die Laptops bringen die Co-Worker selbst mit. An der Rückwand lehnt ein SUP-Brett vor einer Fototapete, welche die nahen Elbauen im Sonnenuntergang zeigt. Der Arbeitsraum liegt nicht in Berlin-Kreuzberg oder im Hamburger Schanzenviertel, sondern in Wittenberge in der Prignitz, im Nordwesten Brandenburgs. An diesem Freitagnachmittag sind nur drei Co-Worker anwesend; 30 sind es insgesamt, die sich die von der Stadt zur Verfügung gestellte Örtlichkeit teilen.
Alte Wohnzimmersessel, Lampenschirme mit Quasten, zusammengesteckte Schreibtische aus MDF, bunte Teppiche, Zimmerpflanzen und ein abgestelltes Fahrrad – dieser Co-Working-Space kommt dem eigenen Klischee recht nahe. Auf der großzügigen Fabriketage stehen 15 locker verteilte Arbeitsplätze mit Computer-Monitoren und Druckeranschluss. Die Laptops bringen die Co-Worker selbst mit. An der Rückwand lehnt ein SUP-Brett vor einer Fototapete, welche die nahen Elbauen im Sonnenuntergang zeigt. Der Arbeitsraum liegt nicht in Berlin-Kreuzberg oder im Hamburger Schanzenviertel, sondern in Wittenberge in der Prignitz, im Nordwesten Brandenburgs. An diesem Freitagnachmittag sind nur drei Co-Worker anwesend; 30 sind es insgesamt, die sich die von der Stadt zur Verfügung gestellte Örtlichkeit teilen.Vor drei Jahren haben sich die Elblandwerker als „Kooperative für Arbeit, Leben und Wandel“ gegründet. Die Stadt Wittenberge hatte nach Wegen gesucht, um dem tristen Leerstand vieler Gebäude und der grassierenden Landflucht zu begegnen und 2019 den Summer of Pioneers ausgerufen. Im Rahmen dieses Wettbewerbs wurden 20 Digitalarbeitende aus Großstädten wie Berlin, Hamburg und Zürich ausgewählt und eingeladen, für ein halbes Jahr ihre Zelte in Wittenberge aufzuschlagen.
Ausprobieren auf Zeit
„Probewohnen und Co-Working auf dem Land“ lautete das Motto, das viele Stadtverdrossene anzog, die für ihren Lebensunterhalt nicht viel mehr als eine schnelle Internet-Verbindung benötigen. Die Kommune stellte einen Co-Working-Space in einem alten Fabrikareal zur Verfügung, die städtische Wohnungsgesellschaft stiftete möblierte Wohnungen zum Pauschalpreis. „Der Schritt, dauerhaft aufs Land zu ziehen, ist für viele Städter eine große Hürde“, sagt Martin Hahn, Bauamtsleiter von Wittenberge, der das Projekt maßgeblich unterstützt. „Mit dem Summer of Pioneers wurde eine Idee geboren, genau diese Hürde zu überwinden: Wohnen auf Zeit, Ausprobieren auf Zeit. Ich sehe in diesem Wohn- und Lebensmodell eine Chance für beide Seiten. Sowohl für diejenigen, die aus den Metropolen aus diversen Gründen aufs Land wechseln wollen. Aber auch für Kleinstädte im ländlichen Raum, weil sie Zuzug und kreative Ideen brauchen, um sich weiterentwickeln zu können.“
Einer der Pioniere, der 2019 nach Wittenberge kam und seitdem dort lebt und arbeitet, ist Christian Soult. Der freiberufliche PR-Manager und Projektberater stammt aus dem nahe gelegenen Pritzwalk und hat mehr als 20 Jahre in Berlin verbracht, bis er vom Summer of Pioneers erfuhr und sich für die Teilnahme bewarb. „Berlin wurde mir damals zu voll. Ich war viel in der Tech- und Start-up-Szene unterwegs, wo sich die Events überschlugen. Ich wollte es ruhiger haben und mich dennoch einbringen und engagieren“, erinnert sich Soult, der nun als Community-Manager unter die Elblandwerker gegangen ist.
Gemeinschaft für alle
Gegenwärtig sind in dem Netzwerk rund 300 Mitglieder versammelt. Dazu gehören die zugezogenen Digitalarbeiter wie etwa Software-Entwickler, Grafiker, IT-Berater und Produktentwickler sowie Entrepreneure wie die Firma Amos IT, die sich auf die Digitalisierung von Kirchen und karitativen Einrichtungen spezialisiert hat. Aber auch „normale“ Menschen aus Wittenberge – Ärzte, Verwaltungsmitarbeiter, Hebammen, Tischler und Lehrerinnen – gehören dazu. Der Mittelpunkt aller Aktivitäten ist der Stadtsalon Safari mitten im Zentrum, den die städtische Wohnungsgesellschaft für günstige Mietkonditionen zur Verfügung stellt. Dort finden regelmäßig Netzwerktreffen, Reparaturcafés, Workshops und der Easy Friday statt, ein wöchentlicher Jour fixe. „Wir Elblandwerker haben von Anfang an die Stadtgesellschaft von Wittenberge einbezogen und unsere Gemeinschaft für Veranstaltungen und Angebote für alle geöffnet“, sagt Christian Soult. „Die Alteingesessenen, Zugezogenen, ganz Neuen und Interessierten ergeben eine kreative Mischung an Menschen, die sich für den Ort und die Region engagieren.“
In der Zwischenzeit ist der Co-Working-Space aus der Ölmühle in das Technologie- und Gewerbezentrum Prignitz (TGZ) am Stadtrand umgezogen und soll voraussichtlich Ende 2025 in den dann neu renovierten Bahnhof kommen, ein prunkvolles klassizistisches Gebäude, das gerade zum Gründerzentrum ausgebaut wird. Wittenberge liegt an der ICE-Trasse zwischen Berlin und Hamburg und wird auch von einigen Schnellzügen angesteuert, sodass die Fahrt in beide Richtungen nur etwa eine Stunde dauert.
Digital gut aufgestellt
Ein weiteres Plus ist die gut ausgebaute digitale Infrastruktur. „Die hiesige Wohnungswirtschaft hat mit einem Telekommunikationsanbieter eine Vereinbarung geschlossen, dass alle verwalteten Wohnungen bis 2024 eine Gigabitversorgung mit Glasfaser bekommen“, erklärt Bauamtsleiter Hahn. „Das ist ein wesentlicher und wichtiger Beitrag, um am Standort Wittenberge Remote Work leisten zu können.“ Ebenso ist der 5G-Mobilfunk – anders als in vielen anderen ländlichen Regionen Brandenburgs – bereits flächendeckend ausgebaut, und auch die Verwaltung arbeitet mit Hochdruck an der eigenen Digitalisierung. Aus dem Blickwinkel der Standortpolitik haben sich die Bemühungen gelohnt. „Zahlreiche Interessierte sind nach Wittenberge gekommen, haben sich den Standort angeschaut und einige sind geblieben“, sagt Martin Hahn. „Wir können statistisch nachweisen, dass der Zuzug aus Hamburg und Berlin größer ist als der Wegzug, wir haben einen positiven Wanderungssaldo.“
Schon vor der Corona-Pandemie haben viele kleinere Gemeinden einen vermehrten Zuzug aus den Großstädten erfahren – vor allem die Kommunen im jeweiligen Speckgürtel. Kleinstädte wie Wittenberge mit seinen 19.000 Einwohnern profitieren dagegen von einer neuen Landlust unter den Digitalarbeitern. Bundesweit entstehen immer mehr Co-Working-Spaces und vergleichbare Projekte. Sei es im brandenburgischen Prädikow, in Gettorf in Schleswig-Holstein, in Mittweida oder Bad Belzig. Jemand, der diesen Trend früh erkannt und aufgegriffen hat, ist Frederik Fischer, der mit seiner Beratungsagentur Neulandia den Summer of Pioneers entwickelt hat und kleinen Kommunen dabei hilft, „Großstädter anzulocken“, wie „Der Spiegel“ schrieb. In der brandenburgischen Gemeinde Wiesenburg/Mark will Fischer ein so genanntes Kodorf bauen, welches 40 Wohnhäuser unterschiedlicher Größe und mehrere Gemeinschafts- und Arbeitseinheiten vorsieht und dem Gemeinschaftsgedanken verpflichtet ist.
Leerstände kreativ zwischennutzen
Gewöhnlich ist aber das Gegenteil von Neubau besonders attraktiv für digitales Landleben, nämlich der Leerstand. Leere Gebäude und freie Gebäudeflächen in Innenstadtlage laden neue Nutzungsformen geradezu ein. Anfang Juni fand in Perleberg eine Konferenz zum Thema „Vom Leerstand zur Zwischennutzung:
 Innovative Konzepte für lebenswerte Räume“ statt. Sie war der offizielle Abschluss des vom Bundesbauministerium mit 250.000 Euro geförderten Projekts PopUp Prignitz. Hintergrund sind die in Ostdeutschland besonders starken Abwanderungsbewegungen nach der Wende und die in den vergangenen Jahren deutliche Zunahme des Online-Handels. Sichtbarer Effekt: Innenstädte verwaisen, Gebäude stehen leer, in vielen Gemeinden existieren kaum noch Orte der sozialen Begegnung. „In der Prignitz gibt es nach fast drei Jahrzehnten Abwanderung heute viel Leerstand, der gerade in den Innenstädten das Stadtbild stark prägt, wie es bundesweit nur noch in wenigen Regionen der Fall ist“, sagt Felicitas Nadwornicek, Projekt-Managerin bei PopUp Prignitz.
Innovative Konzepte für lebenswerte Räume“ statt. Sie war der offizielle Abschluss des vom Bundesbauministerium mit 250.000 Euro geförderten Projekts PopUp Prignitz. Hintergrund sind die in Ostdeutschland besonders starken Abwanderungsbewegungen nach der Wende und die in den vergangenen Jahren deutliche Zunahme des Online-Handels. Sichtbarer Effekt: Innenstädte verwaisen, Gebäude stehen leer, in vielen Gemeinden existieren kaum noch Orte der sozialen Begegnung. „In der Prignitz gibt es nach fast drei Jahrzehnten Abwanderung heute viel Leerstand, der gerade in den Innenstädten das Stadtbild stark prägt, wie es bundesweit nur noch in wenigen Regionen der Fall ist“, sagt Felicitas Nadwornicek, Projekt-Managerin bei PopUp Prignitz.An der Konferenz nahmen Menschen aus der ganzen Republik teil, um über unterschiedliche Zwischennutzungsformate zur Belebung von Innenstädten zu diskutieren und Beispiele für temporäres Leerstandsmanagement aufzuzeigen. Der Leipziger Verein Haushalten e.V. engagiert sich beispielsweise schon seit 15 Jahren dafür, gründerzeitliche Gebäude vor Abriss und Verfall zu schützen und darin so genannte Wächterhäuser zu etablieren, wo Kreativorte, Kompetenzzentren und Kiezkulturläden entstehen. In Angermünde bietet das „Haus mit Zukunft“ Raumstipendien für Kreativarbeitende an. Und in Hamburg sorgt das Förderprogramm Frei-Fläche für bezahlbaren Raum für die kreative Zwischennutzung. Auch wenn sich die Situation in Großstädten und in der Provinz deutlich unterscheidet – Raummangel auf der einen Seite, dauerhafter Leerstand auf der anderen – bildet die Idee einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklungspolitik wohl in beiden Fällen die Grundlage.
Open-Source-Plattform macht Freiräume sichtbar
„PopUp Prignitz wurde aus dem Wunsch heraus ins Leben gerufen, die vielen Freiräume überregional sichtbar, und damit wieder nutzbar zu machen“, sagt Felicitas Nadwornicek. Auf der Website Freiraum-Prignitz.de sind ein gutes Dutzend Immobilien in der Region aufgeführt, die gegenwärtig leer stehen und einer Zwischennutzung oder Neubelebung entgegensehen. Vom kleinen Café neben dem Ärztezentrum in Wittenberge über einen Konferenzraum in Bad Wilsnack bis hin zur Sporthalle. „Um eine Übertragbarkeit auf weitere Städte und Gemeinden zu gewährleisten, ist unsere Plattform Open Source und kann damit nachgenutzt werden“, so Nadwornicek. „Jede Kommune, die das nutzen und ihre Leerstände annoncieren möchte, kann mit uns in Kontakt treten. Die Plattform kann eigenständig übertragen werden – gerne stellen wir aber auf Wunsch auch den Kontakt zu unserem Entwickler-Team zur Verfügung.“
Initiiert und entwickelt wurde das PopUp-Prignitz-Projekt von Neuland 21, einem gemeinnützigen Think-and-Do-Tank, der sich für innovative Regionalentwicklung einsetzt und darauf spezialisiert ist, mit Förderprojekten für mehr digitale Lebensqualität im ländlichen Raum einzutreten. Der Verein ist in vielen unterschiedlichen Bereichen aktiv und setzt gemeinwohlorientierte Projekte mithilfe von öffentlichen Fördergebern und Partnerorganisationen um. So gibt es beispielsweise die Programmierwerkstatt CoderDojo für Kinder und Jugendliche im Hohen Fläming. Das Modellprojekt Heim[at]office untersucht die Potenziale der Arbeitswelt 4.0 für Brandenburger Unternehmen und Remote-Arbeitende. Und OpenDataLand bemüht sich, den Mehrwert von Open Data als Zukunftsthema bei Kommunen im ländlichen Raum zu etablieren.
Studien zeigen Möglichkeiten auf
Im Auftrag des brandenburgischen Wirtschaftsministeriums ist im Herbst 2021 die Studie „Digitale Orte in Brandenburg“ entstanden, eine Art Bestandsaufnahme und gleichzeitig Anleitung zur Selbsthilfe für Kommunen und Initiativen, die digitale Daseinsvorsorge im ländlichen Raum initiieren wollen. Wohnprojekte, Co-Working-Spaces, Makerspaces, Gründungszentren und Retreat-Orte sind nur einige wenige Möglichkeiten für die Ansiedlung von neuen digitalen Landbewohnern. Welche räumlichen Voraussetzungen, regionalen Standortfaktoren, Infrastrukturmerkmale und institutionelle Unterstützung für die Ansiedlung notwendig sind, zeigt die Studie ebenso auf wie wichtige Förderprogramme auf EU-, Bundes- und Landesebene, die dies unterstützen. In Baden-Württemberg ist es beispielsweise im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) möglich, „innovative Gemeinschaftshäuser“ und digitale Orte wie Co-Working-Spaces zu fördern. Im Münsterland wurde dafür der LEADER-Fördertopf genutzt.
Eine weitere Studie von Neuland 21 gilt den „Urbanen Dörfern“ und ist in Zusammenarbeit mit dem Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung entstanden. Sie widmet sich der Frage, welche Standortfaktoren besonders günstig sind für digitales Arbeiten auf dem Land. Am Beispiel des Gutshofs Prädikow wird aufgezeigt, wie es einzelnen Engagierten gelungen ist, rund fünfzig Großstädter für die Idee zu begeistern, sich ein neues digitales Zuhause auf dem Land aufzubauen. „Sicher ist, dass die angeschlagenen ländlichen Regionen nicht nur neue Menschen brauchen, sondern auch neue Ideen und moderne Infrastrukturen, gerade um für junge Leute etwas zu bieten. Auch wenn es absurd klingt: Diese Orte bräuchten etwas von der vielgescholtenen Gentrifizierung, die in den Städten als Ungemach gilt. Denn nur, wenn sie attraktiver werden, wenn Zuzügler von außen für neues Leben sorgen, wenn die Orte eine Aufwertung erfahren, dann können sich auch die lange brachliegenden Bauten wieder füllen“, schreiben die Autoren der Studie.
Neue Umgebung für urbane Milieus
Daran lässt sich erkennen, dass der digitalen Landlust eine hohe Anspruchshaltung zugrunde liegt. Die Digitalarbeiter aus den Wissens- und Kreativberufen wollen als Grundvoraussetzung in der Provinz genau das vorfinden, was sie in der Stadt hinter sich gelassen haben beziehungsweise nicht realisieren konnten: perfekte Internet- und Telekommunikationsinfrastrukturen, ein zuverlässiger Nahverkehr mit rascher Anbindung an die Zentren, genügend Räumlichkeiten zur freien Arbeitsgestaltung, Freiräume für neue Wohnprojekte und die soziale Begegnung. Wenn Kommunen diese Motive und Bedarfe richtig verstehen und gezielt unterstützen, kann die Wiederbesiedlung als Dorf 4.0 gelingen. Gewissermaßen gelangen urbane Milieus in eine neue Umgebung, die sie nach ihren Vorstellungen und Bedürfnissen umgestalten und urbanisieren. Von daher unterscheiden sich dann die Co-Working-Spaces auch nicht sonderlich voneinander – egal ob sie in Berlin-Kreuzberg, im Münchner Gärtnerviertel oder eben in Wittenberge oder Prädikow liegen.
Helmut Merschmann
https://www.elblandwerker.de
Die Studie Digitale Orte in Brandenburg (Deep Link)
Die Studie Urbane Dörfer (Deep Link)
Dieser Beitrag ist in der Ausgabe August 2023 von Kommune21 erschienen. Hier können Sie ein Exemplar bestellen oder die Zeitschrift abonnieren. (Deep Link)
Stichwörter: Politik, Co-Working-Spaces, ländlicher Raum
Bildquelle v.o.n.u.: Helmut Merschmann, Helmut Merschmann
Anzeige
Weitere Meldungen und Beiträge aus dem Bereich Politik
Vitako: Kommunale IT besser schützen
[18.6.2024] Cyber-Attacken legen zunehmend kommunale Verwaltungs-IT lahm. Dabei entstehen enorme Schäden für Verwaltung, Bürger und Wirtschaft. Vitako fordert nun den Ausbau des BSI zur interföderalen IT-Sicherheits-Zentralstelle und die Einordnung kommunaler IT als KRITIS. mehr...
[18.6.2024] Cyber-Attacken legen zunehmend kommunale Verwaltungs-IT lahm. Dabei entstehen enorme Schäden für Verwaltung, Bürger und Wirtschaft. Vitako fordert nun den Ausbau des BSI zur interföderalen IT-Sicherheits-Zentralstelle und die Einordnung kommunaler IT als KRITIS. mehr...
Gesetzgebung: OZG 2.0 kann in Kraft treten
[17.6.2024] Nachdem das vom Bundestag verabschiedete OZG-Änderungsgesetz im Bundesrat gescheitert war, hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat angerufen. Der Einigungsvorschlag des Gremiums wurde nun von beiden Kammern gebilligt. mehr...
[17.6.2024] Nachdem das vom Bundestag verabschiedete OZG-Änderungsgesetz im Bundesrat gescheitert war, hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat angerufen. Der Einigungsvorschlag des Gremiums wurde nun von beiden Kammern gebilligt. mehr...
Bayern: Kommission für Digitalisierung
[12.6.2024] Für neuen Schub bei der Digitalisierung soll die Zukunftskommission #Digitales Bayern 5.0 sorgen. Kommunen und Freistaat wollen gemeinsam einheitliche Strukturen und Standards schaffen. Wie Digitalisierung gelingt, zeigt der Kreis Fürstenfeldbruck. mehr...
[12.6.2024] Für neuen Schub bei der Digitalisierung soll die Zukunftskommission #Digitales Bayern 5.0 sorgen. Kommunen und Freistaat wollen gemeinsam einheitliche Strukturen und Standards schaffen. Wie Digitalisierung gelingt, zeigt der Kreis Fürstenfeldbruck. mehr...
Rheinland-Pfalz: Zusammenarbeit wird gefördert
[7.6.2024] Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt seine Kommunen beim Auf- und Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit. Entsprechende Förderanträge können ab sofort gestellt werden. mehr...
[7.6.2024] Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt seine Kommunen beim Auf- und Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit. Entsprechende Förderanträge können ab sofort gestellt werden. mehr...
Kreis Lüchow-Dannenberg: CDO aus Leidenschaft
Interview
[4.6.2024] Als Leiterin der Stabsstelle für Digitalisierung im Landkreis Lüchow-Dannenberg führt Sabrina Donner mit großem Elan digitale Innovationen ein. Im Interview erklärt sie, was sie am IT-Bereich begeistert und welche Eigenschaften ein CDO mitbringen sollte. mehr...
[4.6.2024] Als Leiterin der Stabsstelle für Digitalisierung im Landkreis Lüchow-Dannenberg führt Sabrina Donner mit großem Elan digitale Innovationen ein. Im Interview erklärt sie, was sie am IT-Bereich begeistert und welche Eigenschaften ein CDO mitbringen sollte. mehr...
Weitere FirmennewsAnzeige
Besuchersteuerung: Das neue Einbürgerungsgesetz stellt Behörden vor zusätzliche Herausforderungen
[12.6.2024] Am 27. Juni 2024 tritt das neue deutsche Einbürgerungsgesetz in Kraft. Damit verkürzt sich die Mindestaufenthaltsdauer für eine Einbürgerung von derzeit acht auf fünf Jahre, bei besonderen Integrationsleistungen sogar auf bis zu drei Jahre. Demzufolge werden Ausländerbehörden künftig mehr Anträge auf Einbürgerung bearbeiten müssen. Allerdings stoßen bereits heute viele Ausländerbehörden an ihre Kapazitätsgrenzen. Magdalene Rottstegge, zuständig für das Business Development bei der SMART CJM GmbH, erläutert, wie Ämter das erhöhte Arbeitsaufkommen besser bewältigen können. mehr...
E-Rechnung: Für den Ansturm rüsten
[31.5.2024] Die E-Rechnungspflicht im B2B-Bereich kommt. Kommunen sollten jetzt ihre IT darauf ausrichten. Ein Sechs-Stufen-Plan, der als roter Faden Wege und technologische Lösungsmöglichkeiten aufzeigt, kann dabei helfen. mehr...
Suchen...
Anzeige
Aboverwaltung
Aktuelle Meldungen

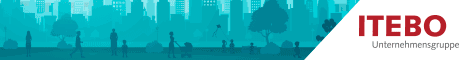







 d.velop AG
d.velop AG



